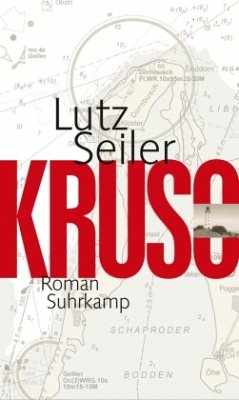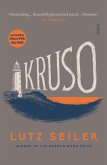Kruso von Lutz Seiler - Aus der Redaktion
Poetisch, kraftvoll, magisch - Lutz Seilers Robinsonade "Kruso"
Sommer 1989, Insel Hiddensee. Lutz Seiler beschwört in "Kruso" kraftvoll und poetisch ein Paralleluniversum für all die, die in der damals noch existierenden DDR aus dem Raster, dem System gefallen sind. Ein Eldorado für Aussteiger, Unangepasste, Antragsteller und auch Abenteurer.
Einer, der auf der Insel strandet, ein Schiffbrüchiger des Lebens, ist Edgar Bendler, genannt Ed. Seine Lebensgefährtin ist bei einem Unfall mit einer Straßenbahn getötet worden - gemeinsam studierten sie in Halle, Ed saß an einer Abschlussarbeit über den Dichter Georg Trakl. Nun fühlt er sich "fremd in einem alten, ehemals eigenen Leben, wie ein Mann ohne Land" - Zeit, zu gehen, Zeit, neu anzufangen.
Der "Klausner" - ein pulsierendes, warmes, eigenen Gesetzen gehorchendes Zuhause
Hiddensee empfängt Ed zuerst frostig, verschlossene Türen, ausgebuchte Unterkünfte. Doch dann öffnet sich die Tür der Gaststätte "Klausner" und das Lokal nimmt ihn auf in ein pulsierendes, warmes, eigenen archaischen Gesetzen gehorchendes Zuhause. Ed verdingt sich als Arbeitskraft, bekommt dafür Kost und Logis. Sein Zimmer, das Giebelzimmer am Ausgang der Treppe, wirkt bewohnt, eine Brille steht noch im Zahnputzbecher, das Bettzeug benutzt, die Tapete schält sich von der Wand ... doch Ed fühlt sich geborgen und beginnt am 15. Juni 1989 seinen Job in der Küche. Ed schält Berge von Zwiebeln mit dem Kleinenspitzen, muss sich beweisen. Doch der, von dem alle sprechen und vor dem er sich vor allem beweisen muss, ist gerade noch unterwegs: Kruso.
Alexander Krusowitsch, genannt Kruso, und der Beginn einer Freundschaft
Alexander Krusowitsch, Kruso, scheint so etwas wie der Inselguru zu sein, der Name russisch klingend, aber er sieht mit seinem schwarzen, halblangen Haar eher aus wie ein Indianer. Alles, was Kruso tut, tut er mit Würde, Ernst und Stolz: Teller abwaschen genauso wie magische Rituale durchführen. Die erste Begegnung zwischen Ed und Kruso ist der Beginn einer Freundschaft. Der Beginn einer Einweisung in das Leben, mit Freundlichkeit und Zärtlichkeit.
In "Kruso" scheint die Insel trotz Grenzpatrouillen - Dänemark ist schließlich nur 50 Kilometer weit entfernt, und wer sich zu weit aufs Wasser hinauswagt, gilt als Republikflüchtling - magisch, märchenhaft-wild, eine Oase des Anderssein-Könnens. Der "Klausner" ist die Arche, die Arbeit zur Stoßzeit am Mittag, Maloche, derb, roh, Akkord - für alle.
"In den ersten Stunden wusch und schrubbte Ed, ohne aufzublicken. Die abgeschnittenen Fettstreifen, die ineinandergerührten Reste, die Papiertaschentücher voller Rotze oder Blut, die Schiffstickets, die Merkzettel, die Kaugummis, die verknoteten Haargummis (an denen ein paar ausgerissene Haare hingen), die Kippen, die Kotze, die Sonnencreme, der ganze Abfall, der auf den Tellern von der Terrasse zurückkam in den Abwasch, das alles war jetzt Teil seiner Arbeit. [...] Die Teller tauchten im Sturzflug an Eds rotierenden Händen vorbei und vollführten erst Zentimeter vor dem Aufprall eine nicht mehr für möglich gehaltene Wendung, um sich schließlich waagerecht und geschmeidig wie träumende Flundern auf den Grund des Beckens zu legen."
Das Leben in einer schön-utopischen Welt: frei, so frei, wie es unter diesen Umständen sein kann
Das Leben aber in dieser Zwischenwelt ist frei, so frei, wie es sein kann unter diesen Umständen. Das liegt auch an Kruso, dem Freigeist und Trakl-Bewunderer, der in Edgar einen Seelenbruder gefunden hat. Vielleicht auch am berauschenden Haarwuchsmittel mit dem bezaubernden Namen "Exlepäng", das in mancher abendlicher Runde kursiert. Oder an den Ritualen und berauschenden Literaturzirkeln in einem betörenden Sommer im historischen Jahr 1989.
Die Grenzen werden löchrig, die Reihen lichten sich
Aber diese schön-utopische Welt mit Kruso auf der Insel ist dem Untergang geweiht. Die Reihen lichten sich, Stück für Stück fehlt ein Mitglied der "Klausner"-Mannschaft, die Grenzen werden löchrig, irgendwann ist das Tor zur Kaserne nicht mehr verriegelt. Die Wachen sind weg, die Grenzen offen - ob da draußen auch wirklich die Freiheit wartet - und was genau ist das eigentlich? Ed hatte sie auf gewisse Weise hier gefunden - ob er sie hinüberretten kann in die neue Welt, wer weiß ...
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Diesem Buch wünscht Jürgen Verdofsky Dauer. Zwischen Hilbig und Johnson gesellt er den Autor, weil der wie nie zuvor der Grenzflucht-Toten zwischen Hiddensee und Dänemark gedenkt, wie Verdofsky schreibt, weil er untröstlich und heiter zugleich erzählt, aufklärt und Geheimnis schafft und jedenfalls eine seltene Literatur schreibt, wie der Rezensent versichert. Die Geschichte des Abwäschers Kruso zwischen Stasi und Subversion erzählt der Autor dabei behutsam, so Verdofsky, mit wenig Metaphernaufwand und so, dass sich die Schichten im Text in den Augen des Rezensenten beinah von allein ineinander bewegen. Kunstvoll leicht erscheint ihm dies Erzählen, sanft surrealistisch, und dahinter eine "feste" Geschichte.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Anmerkungen zu einem Bestseller: Warum ich Lutz Seilers "Kruso" anders lese als manche von seiner Sprachgischt benommenen Kritiker.
Von Wolfgang Hegewald
Auch wenn niemand sagen kann, wie ein Bestseller entsteht, so sind gewiss immer Zeitumstände daran beteiligt, die eine Rezeptionsempfänglichkeit begünstigen. Wenn in der Gesellschaft diffuse Ängste rumoren und grassieren, die Furcht vor Abstieg und Wohlstandsverlust umgeht, dann wird das Raunen der Utopie wieder lauter.
Sprache und Erzählen sind Erkenntnisinstrumente, die nicht nur durch die Weltdeutungsleistungen des Autors überraschen, sondern gelegentlich auch gespenstische Fehldeutungen offenlegen, auf der autorenabgewandten Seite des Textes gleichsam. Die Sieger der Rezeptionsgeschichte (Bestseller genannt) respektive ihre Autoren mögen die (vor-)herrschende Lesart in Beton gießen lassen; Erzählsystemen haftet allemal ein subversiver Eigensinn an. Der Wortlaut gilt und bringt es an den Tag. An robusten Bestsellern wie "Die Blechtrommel" von Günter Grass und "Der Vater eines Mörders" von Alfred Andersch, Büchern, die längst zum kanonischen Bestand antifaschistischer Nachkriegsliteratur gerechnet werden, hat Petra Morsbach durch präzise Lektüre solche Deutungsstörungen aufgezeigt ("Warum Fräulein Laura freundlich war - Über die Wahrheit des Erzählens", München 2006).
Der Roman "Kruso", so schallt es mir nun allenthalben und fast unisono entgegen, vergegenwärtige virtuos mit den Mitteln des magischen Realismus die historische Möglichkeitsform eines Lebens in und zugleich jenseits des Verhängnisses namens DDR. Während der Staat in seinen letzten Zügen lag, erprobte das verwegene Kollektiv der Saisonkräfte auf Hiddensee, der Insel des Freiheitsgerüchts, kontrafaktisch ein freiheitlich-utopisches Lebenskonzept. In phantastischer Sprachgischt leuchte diese Möglichkeit auf, die den inneren Ausreiseantrag nobilitiere.
Die Alternative, elitär und fast mythischen Ranges, aus der Sicht der Saisonkräfte: die Flucht übers Meer. Wer sie wählte, hat zuvor in die absolute Freiheit des Todes eingewilligt. Einige Kritiker scheinen, von der Lektüre benommen, in der Insel Hiddensee sogar eine Art Zonen-Macao zu vermuten, eine geistig-moralische Freihandelszone der DDR.
Ich lese, salopp gesagt, etwas anderes in "Kruso": Auf dem Eiland wiederholt sich das ganze Elend des kleinen verrotteten Landes als Farce und Satyrspiel. In der Tyrannei der Aussteiger spiegelt sich die Lebenswelt der DDR en miniature. Das "Moratorium des Alltags" (Odo Marquardt), das die eingeschworene Inselgemeinschaft zu praktizieren vorgibt, ist mit ebendiesem Alltag derart kontaminiert und von ihm korrumpiert, dass es sich selbst suspendiert.
Doch je weiter meine Lektüre von "Kruso" fortschritt, desto fragwürdiger kam es mir vor, dass mein Deutungsmuster der Intention von Autor oder Text entspreche. Von der Kritik ganz zu schweigen, die bald vor allem davon handelte, dass einem auch keine anderen Superlative zu "Kruso" einfielen als dem Kollegen von der Nachbarzeitung. Aber das kann man dem Roman nicht ankreiden.
"Kruso" ist ein Entwicklungs- und Initiationsroman. Ed Bendler, Germanistikstudent aus Halle, von Trakls Vers trunken und durch einen Verlust traumatisiert, bricht zu einer abenteuerlichen Reise nach Hiddensee auf. Dort erhält er, im letzten Sommer der DDR, eine prekäre Anstellung, eine provisorische Unterkunft, und er findet Blutsbrüder, allen voran Kruso. Und Ed fungiert als Erzähler. Kruso verkörpert in Personalunion den Inselschamanen, den gütigen Bonzen mit diktatorischen Allüren, einen verquasten Charismatiker vom Schlage Sascha Andersons, einen Freiheitsapostel und Weisheitslehrer (oft kaum mehr als ein Spruchbeutel voll pathetisch-trivialer Sentenzen à la "Nur Unfreiheit gebiert die wahre Freiheit") - und er wird für Ed zum existentiellen Faszinosum, mit einer homoerotischen Unterströmung.
Diese Konstellation stürzt mich, den Leser, in ein dramaturgisches Dilemma: Eds Erzählung will vor allem treues Vermächtnis sein, eine Art Evangelium nach Kruso, das weder hagiographische Arabesken noch liturgische Wiederholungen scheut. Das macht mir die Lektüre bald lang. Denn Kruso ist, trotz all seiner kapriziösen Volten, berechenbar wie sein Credo: Wir bleiben hier!
Diese bis in die Jetztzeit des Epilogs reichende Anhänglichkeit Eds an Kruso hat erzählerische Scheuklappeneffekte zur Folge und fermentiert den fast 500 Seiten dicken Roman mit einer Gläubigkeit, die mich befremdet. Zu den Konsequenzen dieser Erzählperspektive ist, so meine ich, auch die chronische Humorlosigkeit der über weite Passagen eindrucksvoll modulierten Prosa zu rechnen. Ein Sektierer wie Ed hat keinen Sinn für abgründige Komik, die ich in etlichen Szenen wittere.
Religiöse und parareligiöse Muster finden sich in "Kruso" allenthalben; das Ausflugslokal "Klausner", wo Ed wohnt und schuftet, erinnert nicht zufällig an eine Einsiedelei. Krusos raunende Freiheitsrhetorik, meist mit dunklem Guru-Tremolo vorgetragen und vom Jünger Ed enervierend variantenreich repetiert, ließ mich gelegentlich an ein Diktum von G. K. Chesterton denken, eines Autors von religiöser Hellhörigkeit: "Das innere Licht ist die trübste aller Beleuchtungsarten." Was es mit der Menschlichkeit in finsteren Zeiten für eine Bewandtnis hat, lässt sich bei Hannah Arendt nachlesen; sie wusste auch, dass die Menschlichkeit der Erniedrigten und Beleidigten die Stunde der Befreiung nie auch nur um eine Minute überlebt hat.
Eine grob skizzierte, exemplarische Andeutung nur zu der von mir behaupteten Parallelaktion zwischen DDR-Alltag und Kruso-Kommunitäts-Brauch: die "Vergabe". So heißt im Jargon der Sekte die zeremoniell verbrämte Übereignung von Schiffbrüchigen, also ohne Quartiergewissheit auf der Insel eintreffenden Frauen oder Männern, an Saisonkräfte, sexuelle Dienstleistungs- und informelle Auskunftsbereitschaft inbegriffen. Von Kruso als Strandweihespiel in absolutistischer Manier zelebriert. Ed staunt, genießt und macht sich Notizen. Man erinnert sich: Wohnraum war zwischen Rostock und Erfurt knapp, solange die DDR existierte. Wer bei der staatlichen Wohnungsverwaltung vorstellig wurde, sollte zumindest verheiratet sein. Staatlich reglementierter Sexualgewahrsam als Vorbedingung, ein halbwegs erträgliches Domizil zu ergattern.
Den von keinem vorhergesehenen Fall der Mauer erleben die in Gemeinschaftspathos und Inseltrotz Internierten (Helmuth Plessner, hilf!) als Weltverlust und narzisstische Kränkung. Hochartifizielle, den Kopf benebelnde Sprachgischt weht in diesen härter werdenden Zeiten von Hiddensee her. Wo der Lurch begraben ist, beginnt der alte Maulwurf wieder zu wühlen. Ist es Rückblick, ist es Vorschein: Das Gespenst der Utopie geht um.
Der Schriftsteller Wolfgang Hegewald, geboren 1952 in Dresden, verließ 1983 die DDR und ging in die Bundesrepublik. Zuletzt erschien sein Roman "Herz in Sicht" (Matthes & Seitz).
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Lesen Sie diesen hochpoetischen Roman!« Ijoma Mangold ZEIT ONLINE 20140919