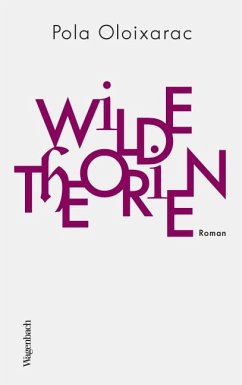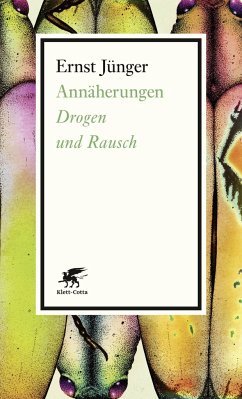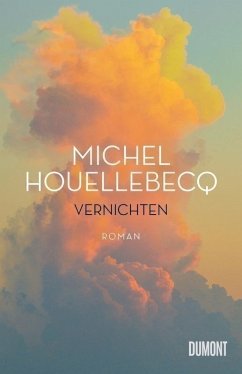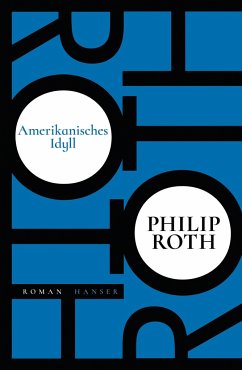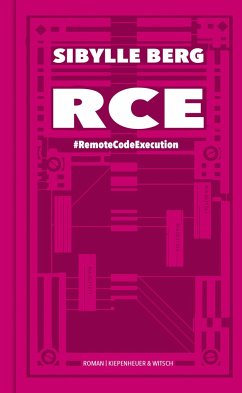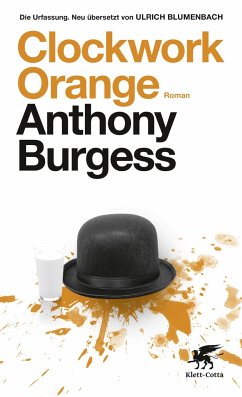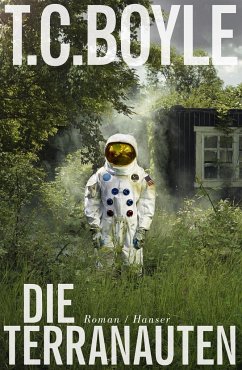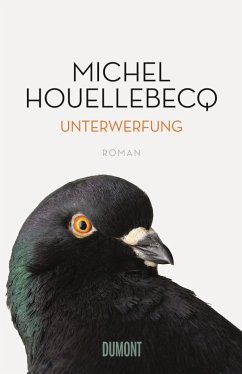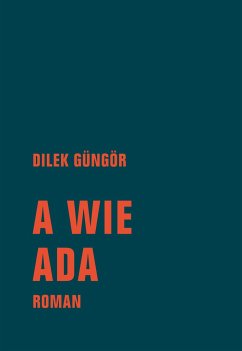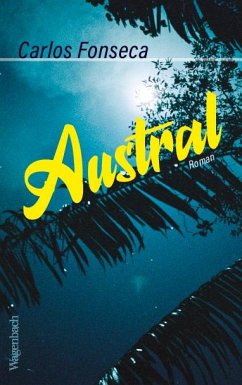Nicht lieferbar

Kryptozän
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Zu Beginn der 1980er Jahre kommen sich in der subtropischen Sommerhitze Brasiliens eine Anthropologin und ein Flugzeugingenieur näher. Das Resultat dieser Verbindung von jüdisch-argentinischer und brasilianischer DNA heißt Cassio Liberman Brandão da Silva: Der Held ist geboren.Sozialisiert mit Castle Wolfenstein und Musik von den Dead Kennedys, erweist sich Cassio früh als Wunderkind der Kryptografie, dessen Viren in der Hacker-Szene als Kunstwerke betrachtet werden. Doch wie so oft bei Genies ohne Talent zur Entschlüsselung ihrer Mitmenschen, vereinsamt er zusehends. Der Programmierjob ...
Zu Beginn der 1980er Jahre kommen sich in der subtropischen Sommerhitze Brasiliens eine Anthropologin und ein Flugzeugingenieur näher. Das Resultat dieser Verbindung von jüdisch-argentinischer und brasilianischer DNA heißt Cassio Liberman Brandão da Silva: Der Held ist geboren.Sozialisiert mit Castle Wolfenstein und Musik von den Dead Kennedys, erweist sich Cassio früh als Wunderkind der Kryptografie, dessen Viren in der Hacker-Szene als Kunstwerke betrachtet werden. Doch wie so oft bei Genies ohne Talent zur Entschlüsselung ihrer Mitmenschen, vereinsamt er zusehends. Der Programmierjob im Start-up ist eine Beleidigung für sein Gehirn und der Untergrundruhm vergessen - bis aus dem Nerd schließlich ein Weltenretter wird: Als Cassio genetische und digitale Daten zu mischen beginnt, erkennt er eine Wahrheit, die andere Forscher lange vor seiner Zeit bereits erahnt hatten.Auch Pola Oloixarac mischt in Kryptozän den Abenteuer- mit dem Bildungsroman und schafft, angereichert mit einer Prise Science-Fiction und abgründigem Humor à la Houellebecq, den ersten Hackerroman mit philosophischem Tiefgang.