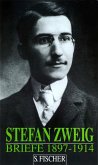Schwere persönliche Erfahrungen haben Luise Rinsers Leben und Denken in den letzten Jahren bestimmt. Krankheit und Tod ihres Sohnes, lange eigene Klinikaufenthalte nach zwei Unfällen haben sie an die Grenze ihrer Existenz geführt. Die Grundfragen des Lebens, die sie von jeher beschäftigen, stellen sich ihr neu und sie findet neue Antworten. Aber vier Monate, so stellt sie fest, "waren in meinem Bewußtsein wie leere Seiten". Mit vier leeren Seiten ist diese Zeit auch in ihrem Tagebuch festgehalten. Ein tief prägendes Erlebnis fällt ins erste der hier dokumentierten Jahre: eine Reise nach Indien auf Einladung des Dalai Lama zu langen Gesprächen. "Fünf Tage, täglich einige Stunden neben ihm, haben mich unerhört viel gelehrt." Diese Begegnung, die auch Anstoß gab zu neuer, intensiver Auseinandersetzung mit den großen Themen der buddhistischen und der christlichen Mystik, beschreibt Luise Rinser als einen "Zustand des gehobenen Glücks". Und in einer anderen Eintragung heißt es: "Glücklich sein: dankbar sein fürs Leben, so wie es ist."
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Das ist alles, alles, alles
Warum guckt Sartre nur so böse: Luise Rinser bekennt weiter
Luise Rinser kann nicht ausruhen, sie muß der Menschheit beistehen. Auch in den letzten Jahren, über die das neue Tagebuch berichtet, war die Erwählte auf ihrem Posten. Wieder hat sie geliebt und gelitten; und wieder bekennt sie sich zu ihrer Güte. Nichts will sie verschweigen, nichts, das die Größe des Herzens offenbart. Von der Ameise, die sie am Weg zertrat, erzählt sie so betroffen wie von den Leprakranken, die sie in Indonesien küßte. Die "Scham", mit der sie den Bettlern "die Scheine" zusteckt, die Geduld, mit der sie sich in das Leid aller Mütter dieser Welt versenkt: alles ist aufeinander abgestimmt, "zum Weinen und Beten schön".
Seite für Seite formt sich die Kopie des vertrauten Bildes, das Porträt einer Beglückten, neben der die heilige Hildegard wie ein sündiges Wesen dasteht. Selbst der Dalai Lama wurde von dieser Größe ergriffen. Stundenlang hat er der frommen Luise in die Augen geschaut. Mit ihr war er "glücklich", mit ihr sprach er über Sexualität, "Hand in Hand", sechs Tage lang. Die Umarmung folgte zum Schluß und "ohne Berührungsscheu". Wo so viel Liebe "verstrahlt", versteht sich die Ehrfurcht von selbst. Die Welt weiß längst, was sie der Rinser schuldet. Als sie wegen einer Hüftoperation für Wochen in die Klinik muß, kann die Autorin beruhigt feststellen, daß ihre Bücher auf den Nachttischen der anderen Patienten ausliegen. Nicht umsonst hat sie "stellvertretend" gelitten.
Die Kranken, die sie uns vorstellt, wissen das ebenso zu schätzen wie die Obdachlosen, mit denen sie nur im Geiste frieren darf, da es ihr als "braver deutscher Bürgerin" verwehrt bleibt, unter den Brücken zu schlafen. Doch die Bettler haben Verständnis, und Mitleid haben sie ohnehin. In München wenigstens kennen sie die Schriftstellerin beim Namen; manchmal kommen sie zu ihren Lesungen, "rasiert, sauber, gut aussehend" und mit "weißen Rosen" unterm Arm. Und wieder ist alles "zum Weinen und Beten schön", auch wenn die weißen Rosen nicht aus Athen kommen. Den Kitsch nämlich mag die Heldin ihres Tagebuchs noch weniger als den Existentialismus; "Schnulzen, wie sie die Spießer lieben", sind ihr so fremd wie Sartres böser Blick. Dann schon lieber "die rote Blume im Haar der Frau" und dazu eine Träne für den Sozialismus, für die Freunde in Asien, für den "Präsidenten Nordkoreas" nicht zuletzt. Denn: "Wofür arbeitet man sonst als für den Weltfrieden, für die Rettung aller?" "Das ist alles" - alles, was Luise Rinser geben kann. THOMAS RIETZSCHEL
Luise Rinser: "Kunst des Schattenspiels". 1994 bis 1997. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1997. 157 S., geb., 34,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Warum guckt Sartre nur so böse: Luise Rinser bekennt weiter
Luise Rinser kann nicht ausruhen, sie muß der Menschheit beistehen. Auch in den letzten Jahren, über die das neue Tagebuch berichtet, war die Erwählte auf ihrem Posten. Wieder hat sie geliebt und gelitten; und wieder bekennt sie sich zu ihrer Güte. Nichts will sie verschweigen, nichts, das die Größe des Herzens offenbart. Von der Ameise, die sie am Weg zertrat, erzählt sie so betroffen wie von den Leprakranken, die sie in Indonesien küßte. Die "Scham", mit der sie den Bettlern "die Scheine" zusteckt, die Geduld, mit der sie sich in das Leid aller Mütter dieser Welt versenkt: alles ist aufeinander abgestimmt, "zum Weinen und Beten schön".
Seite für Seite formt sich die Kopie des vertrauten Bildes, das Porträt einer Beglückten, neben der die heilige Hildegard wie ein sündiges Wesen dasteht. Selbst der Dalai Lama wurde von dieser Größe ergriffen. Stundenlang hat er der frommen Luise in die Augen geschaut. Mit ihr war er "glücklich", mit ihr sprach er über Sexualität, "Hand in Hand", sechs Tage lang. Die Umarmung folgte zum Schluß und "ohne Berührungsscheu". Wo so viel Liebe "verstrahlt", versteht sich die Ehrfurcht von selbst. Die Welt weiß längst, was sie der Rinser schuldet. Als sie wegen einer Hüftoperation für Wochen in die Klinik muß, kann die Autorin beruhigt feststellen, daß ihre Bücher auf den Nachttischen der anderen Patienten ausliegen. Nicht umsonst hat sie "stellvertretend" gelitten.
Die Kranken, die sie uns vorstellt, wissen das ebenso zu schätzen wie die Obdachlosen, mit denen sie nur im Geiste frieren darf, da es ihr als "braver deutscher Bürgerin" verwehrt bleibt, unter den Brücken zu schlafen. Doch die Bettler haben Verständnis, und Mitleid haben sie ohnehin. In München wenigstens kennen sie die Schriftstellerin beim Namen; manchmal kommen sie zu ihren Lesungen, "rasiert, sauber, gut aussehend" und mit "weißen Rosen" unterm Arm. Und wieder ist alles "zum Weinen und Beten schön", auch wenn die weißen Rosen nicht aus Athen kommen. Den Kitsch nämlich mag die Heldin ihres Tagebuchs noch weniger als den Existentialismus; "Schnulzen, wie sie die Spießer lieben", sind ihr so fremd wie Sartres böser Blick. Dann schon lieber "die rote Blume im Haar der Frau" und dazu eine Träne für den Sozialismus, für die Freunde in Asien, für den "Präsidenten Nordkoreas" nicht zuletzt. Denn: "Wofür arbeitet man sonst als für den Weltfrieden, für die Rettung aller?" "Das ist alles" - alles, was Luise Rinser geben kann. THOMAS RIETZSCHEL
Luise Rinser: "Kunst des Schattenspiels". 1994 bis 1997. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1997. 157 S., geb., 34,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Warum guckt Sartre nur so böse: Luise Rinser bekennt weiter
Luise Rinser kann nicht ausruhen, sie muß der Menschheit beistehen. Auch in den letzten Jahren, über die das neue Tagebuch berichtet, war die Erwählte auf ihrem Posten. Wieder hat sie geliebt und gelitten; und wieder bekennt sie sich zu ihrer Güte. Nichts will sie verschweigen, nichts, das die Größe des Herzens offenbart. Von der Ameise, die sie am Weg zertrat, erzählt sie so betroffen wie von den Leprakranken, die sie in Indonesien küßte. Die "Scham", mit der sie den Bettlern "die Scheine" zusteckt, die Geduld, mit der sie sich in das Leid aller Mütter dieser Welt versenkt: alles ist aufeinander abgestimmt, "zum Weinen und Beten schön".
Seite für Seite formt sich die Kopie des vertrauten Bildes, das Porträt einer Beglückten, neben der die heilige Hildegard wie ein sündiges Wesen dasteht. Selbst der Dalai Lama wurde von dieser Größe ergriffen. Stundenlang hat er der frommen Luise in die Augen geschaut. Mit ihr war er "glücklich", mit ihr sprach er über Sexualität, "Hand in Hand", sechs Tage lang. Die Umarmung folgte zum Schluß und "ohne Berührungsscheu". Wo so viel Liebe "verstrahlt", versteht sich die Ehrfurcht von selbst. Die Welt weiß längst, was sie der Rinser schuldet. Als sie wegen einer Hüftoperation für Wochen in die Klinik muß, kann die Autorin beruhigt feststellen, daß ihre Bücher auf den Nachttischen der anderen Patienten ausliegen. Nicht umsonst hat sie "stellvertretend" gelitten.
Die Kranken, die sie uns vorstellt, wissen das ebenso zu schätzen wie die Obdachlosen, mit denen sie nur im Geiste frieren darf, da es ihr als "braver deutscher Bürgerin" verwehrt bleibt, unter den Brücken zu schlafen. Doch die Bettler haben Verständnis, und Mitleid haben sie ohnehin. In München wenigstens kennen sie die Schriftstellerin beim Namen; manchmal kommen sie zu ihren Lesungen, "rasiert, sauber, gut aussehend" und mit "weißen Rosen" unterm Arm. Und wieder ist alles "zum Weinen und Beten schön", auch wenn die weißen Rosen nicht aus Athen kommen. Den Kitsch nämlich mag die Heldin ihres Tagebuchs noch weniger als den Existentialismus; "Schnulzen, wie sie die Spießer lieben", sind ihr so fremd wie Sartres böser Blick. Dann schon lieber "die rote Blume im Haar der Frau" und dazu eine Träne für den Sozialismus, für die Freunde in Asien, für den "Präsidenten Nordkoreas" nicht zuletzt. Denn: "Wofür arbeitet man sonst als für den Weltfrieden, für die Rettung aller?" "Das ist alles" - alles, was Luise Rinser geben kann. THOMAS RIETZSCHEL
Luise Rinser: "Kunst des Schattenspiels". 1994 bis 1997. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1997. 157 S., geb., 34,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main