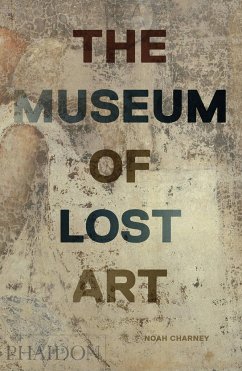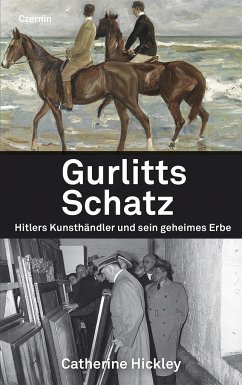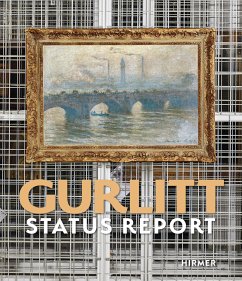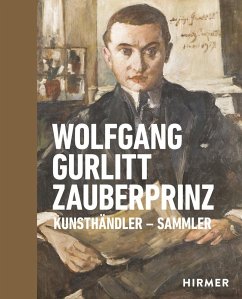Nicht lieferbar

Kunstfund Gurlitt
Wege der Forschung
Herausgegeben: Bahrmann, Nadine; Baresel-Brand, Andrea; Lupfer, Gilbert
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
2013 wurde infolge einer Beschlagnahme der "Schwabinger Kunstfund" in den Blick der Weltöffentlichkeit katapultiert und damit der Kunsthändler Hildebrand Gurlitt (1895-1956), bei dessen Sohn Cornelius (1935-2014) sich die Werke befunden hatten. Eine Taskforce wurde gegründet, um die Herkunft der Werke aufzuklären, welche man wegen Gurlitts Tätigkeit während des Nationalsozialismus als "Raubkunst" verdächtigte. 2014 tauchten weitere Werke aus dem Besitz Gurlitts auf. Im Fokus der Provenienzrecherche zum Kunstfund stand stets die zügige Aufklärung der Herkunft einzelner Werke, nicht jed...
2013 wurde infolge einer Beschlagnahme der "Schwabinger Kunstfund" in den Blick der Weltöffentlichkeit katapultiert und damit der Kunsthändler Hildebrand Gurlitt (1895-1956), bei dessen Sohn Cornelius (1935-2014) sich die Werke befunden hatten. Eine Taskforce wurde gegründet, um die Herkunft der Werke aufzuklären, welche man wegen Gurlitts Tätigkeit während des Nationalsozialismus als "Raubkunst" verdächtigte. 2014 tauchten weitere Werke aus dem Besitz Gurlitts auf. Im Fokus der Provenienzrecherche zum Kunstfund stand stets die zügige Aufklärung der Herkunft einzelner Werke, nicht jedoch die Grundlagenforschung. Im Zuge der komplexen Recherchen und des Umgangs mit dem heterogenen schriftlichen Nachlass ergaben sich jedoch zahlreiche weiterführende und für die Provenienzforschung wichtige Erkenntnisse, die hier in einer Auswahl vorgestellt werden.