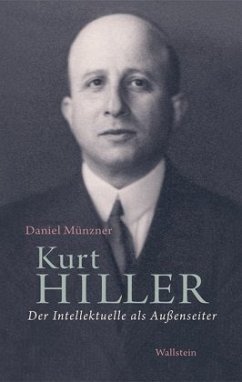Kurt Hiller - Der Prototyp des Linksintellektuellen wandelt sich vom Feind zum Unterstützer der Demokratie.Kurt Hiller (1885-1972) war Pionier des literarischen Expressionismus und einer der bekanntesten Publizisten und Intellektuellen der Weimarer Republik. Als Kind jüdischer Eltern, Homosexueller, Pazifist und Sozialist war er antisemitischen, homophoben und anti-intellektuellen Anfeindungen ausgesetzt. Damit steht er prototypisch für die Figur des diffamierten Linksintellektuellen im 20. Jahrhundert. Der Weltbühnenautor polemisierte bis 1933 gegen die Demokratie und warb für die Herrschaft einer geistigen Elite.Die mahnende Erinnerung an die gescheiterte Weimarer Republik und den NS-Terror, die gute Behandlung im englischen Exil und sein Konflikt mit den Parteikommunisten führten den Staatskritiker Hiller in die Arme des britischen Inlandsgeheimdiensts, für den er fast 15 Jahre als Informant tätig war. Aus diesen Erfahrungen heraus und dank der Integration des linksintellektuellen Milieus durch die SPD wandelte er sich vom Antidemokraten zu einem nachsichtigen, milden Anhänger der sozial-liberalen Koalition unter Willy Brandt.Die erste umfassende biographische Studie über Kurt Hiller ist Literatur-, Intellektuellen- und Geheimdienstgeschichte zugleich und erzählt das facettenreiche Leben eines großen vergessenen Publizisten.Nominiert für den Opus Primum Förderpreis der VolkswagenStiftung 2015
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rezensent Oliver Pfohlmann lässt sich von Daniel Münzner den Nonkonformisten Kurt Hiller vorstellen. Allerdings erkennt er im Buch keine herkömmliche Lebensbeschreibung, sondern den Versuch einer strukturanalytischen, mit den Kategorien "class, race, gender" operierende Überprüfung des Vorwurfs, der "Weltbühne"-Autor Hiller sei wie Tucholsky oder Ossietzky ein linksintellektueller Dauerkritiker gewesen, der sich an der Weimarer Republik vergriffen habe. Dass Hiller mit seiner Ausgrenzungsbiografie sich dafür prototypisch eignet, wie der Historiker Münzner glaubt, bezweifelt Pfohlmann allerdings. Er jedenfalls hält Hiller für eine allzu originäre, schillernde Figur.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Am Beispiel von Kurt Hiller untersucht Daniel Münzner das linksintellektuelle Milieu der Weimarer Republik
Kurt Hiller war ein Querkopf und Nonkonformist. Schon während seines Jura-Studiums im Berlin nach 1900 galt der spätere Autor und Publizist als "Stänkerer" und "Zankapfel". In seiner Autobiographie "Leben gegen die Zeit" (1969) erinnert er sich, wie er sich nach seiner Aufnahme in einer Verbindung dem Biercomment verweigerte: Lieber kassierte er einen "Bierverschiss", statt den ihm von einem "Alten Herrn" hingehaltenen Krug zu leeren, wie es das traditionelle Begrüßungsritual für Neulinge - "Es wird fortgesoffen!" - bis heute vorsieht.
Für stumpfe Männlichkeitsbeweise hatte der schwule Sohn wohlhabender jüdischer Eltern nichts übrig. Stattdessen warb das Neumitglied umgehend für eine Reform, die aus der Verbindung einen philosophischen Debattierzirkel machen sollte. Seine selbstredend erfolglosen Bemühungen brachten ihm den Vorwurf ein, "intellektuell bis auf die Knochen" zu sein und die Verbindung in "einen Verein dekadenter Literaturjünglinge" verwandeln zu wollen.
Das war freilich nur die erste von zahllosen Diskriminierungserfahrungen im Leben des späteren Linksintellektuellen und "Weltbühne"-Autors, der 1933 von den Nazis in verschiedenen Konzentrationslagern monatelang gefoltert wurde, ehe er sich ins Exil retten konnte. Als Hiller 1972 starb, bilanzierte Johann Ernst in dieser Zeitung: "Wäre er auch noch mit dunkler Hautfarbe auf die Welt gekommen, dann hätte er in seiner Person so ziemlich alles versammelt, was den Stachel wider die ,große Zahl' löckt: Antidemokrat, Sozialist, Pazifist, Jude, Verteidiger der Homosexualität und der Abtreibung."
Eine Biographie über den heute fast nur noch als Pionier der expressionistischen Literatur bekannten Publizisten war seit langem überfällig. Doch Daniel Münzners vorzüglich recherchiertes, elegant geschriebenes Vierhundert-Seiten-Werk ist keine Lebensbeschreibung im herkömmlichen Sinn. Vielmehr geht es dem Rostocker Historiker um eine strukturanalytische Überprüfung des Vorwurfs, Linksintellektuelle wie Hiller, Kurt Tucholsky oder Carl von Ossietzky seien mit ihrer Dauerkritik und -polemik die "Totengräber" der Weimarer Republik gewesen und hätten sich am Scheitern des Parlamentarismus in Deutschland mitschuldig gemacht.
Für dieses Vorhaben eigne sich Hiller - von Georg Fülberth einst als "zentrale Randfigur" der Geschichtsschreibung bezeichnet - prototypisch, so Münzner, und zwar gerade aufgrund von dessen vielfältigen Ausgrenzungserfahrungen über mehrere deutsche Geschichtsepochen hinweg. Diese machten nämlich Hillers politische Invektiven gerade in der Zwischenkriegszeit, seine Demokratie- und Parteienkritik, als "Reaktion" verstehbar: "Wer wie Hiller die Weimarer Republik auch als einen Ort eines permanenten Antisemitismus, der Homophobie und der Gerichtsprozesse gegen linke Kritiker erlebte, für den gab es nichts zu verteidigen, sondern nur eine bessere, eine echte Republik zu erkämpfen."
Münzner gelingt es dabei, in dem als notorischen Parteienverächter bekannten Publizisten einen "Vernunftrepublikaner" zu entdecken, der je nach den Umständen bei Reichstagswahlen für oder gegen die SPD warb oder 1932 Heinrich Mann als linken Einheitskandidaten für das Amt des Reichspräsidenten vorschlug. Bezeichnenderweise habe der späte Hiller in der Bundesrepublik, in der er erheblich weniger Diskriminierungen sowie eine wachsende politische Unterstützung für den Kampf gegen den Paragraphen 175, die "Schmach des Jahrhunderts", erlebte, seinen Frieden mit dem Parlamentarismus gemacht.
Das klingt zunächst plausibel, und doch stellt sich nach der Lektüre von Münzners Studie, deren Aufbau sich an den klassischen Kategorien der Ungleichheitsforschung (class, race, gender) orientiert, die Frage, inwieweit sich Hiller überhaupt als "prototypischer" Linksintellektueller bezeichnen lässt. War er dafür nicht eine viel zu originäre Figur? Sein Verhältnis zu Mitstreitern beispielsweise, sei es in Magnus Hirschfelds "Wissenschaftlich-humanitärem Komitee" zur Liberalisierung des Sexualstrafrechts oder nach 1918 in der Deutschen Friedensbewegung, hing zeitlebens primär von deren Bildungshintergrund ab. Nicht anders das zu Politikern: Münzner zeigt, dass Hiller in der Zwischenkriegszeit mit der SPD schon allein aufgrund seiner "habituellen Differenz" zu dem "Sattlergesellen" Friedrich Ebert fremdelte, während er in den Sechzigern vor einem intellektuellen Kopf wie Willy Brandt umso mehr Respekt hatte.
Hillers Ideal war aber nicht nur der gebildete, sondern auch der sportlich gestählte Mann ("Bauch und Geisteskampf schließen einander aus") - Frauen waren bei diesem "Maskulinisten" (Münzner) nur für Hilfsarbeiten vorgesehen. Noch für den späten Hiller, der im Hamburg der sechziger Jahre als eine Art linkssozialistischer Stefan George und "Apo-Opa" einen Studentenkreis um sich scharte, war, nach einer Erinnerung von Klaus Rainer Röhl, "der Gedanke unerträglich", dass er bei der anstehenden Bundestagswahl "nur ebenso viele Stimmen habe wie (seine) Reinemachefrau".
Darauf, dass Hillers Herrschaftskonzept, das Menschen ohne akademische Bildung ausgrenzte, "eine deutliche Nähe zu rechten Denkern" aufwies, weist Münzner selbst hin. Das platonische Vorbild für Hillers lebenslangen politischen Traum von einer "Logokratie", einer Herrschaft des Geistes über die Masse anstelle einer "Diktatur der Mittelmäßigkeit" vulgo Demokratie, ist offenkundig. Umso ironischer, dass sein in der Novemberrevolution 1918 flugs gegründeter "Rat geistiger Arbeiter" mit eigenem Sitzungsraum im Reichstag, der eine kompetenzorientierte politische Führung der Intellektuellen und Künstler forderte, umgehend an der politischen Inkompetenz aller Beteiligten scheitern sollte.
OLIVER PFOHLMANN
Daniel Münzner: "Kurt Hiller". Der Intellektuelle
als Außenseiter.
Wallstein Verlag,
Göttingen 2015. 414 S., geb., 39,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»eine thematisch innovative, sehr gut und spannend geschriebene Arbeit (...), welcher (...) viele Leser zu wünschen sind.« (Thomas Vordermayer, Sehepunkte, 20.05.2016) »vorzüglich recherchiertes, elegant geschriebenes (...) Werk.« (Oliver Pfohlmann, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.06.2016) »eine fundierte und gut zu lesende Biografie« (Max Bloch, Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, Heft 7-8/2016) »ein wichtiger Beitrag zur Intellektuellengeschichte der Weimarer Republik und der frühen Bundesrepublik« (Tim Lörke, Germanistik, 2015 Band 56 Heft 3-4)