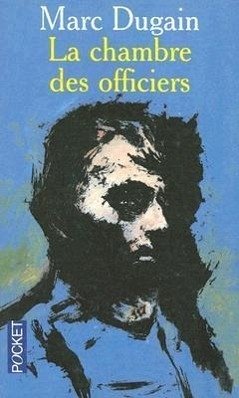Venise, cité sinueuse, est un labyrinthe imprévisible. Et Catherine Parrish, jeune New-Yorkaise angoissée par son mariage imminent, entend bien s'y perdre. Au prétexte d'une thèse en histoire de l'art, la voilà débarquée dans la Sérénissime, goûtant chaque ruelle, chaque canal, chaque campo reculé avec émerveillement. La découverte d'une synagogue secrète et oubliée, ainsi que la rencontre de Marco, gondolier tourmenté, vont l'initier aux arcanes de la ville jaillie de la mer, la forçant à sortir des sentiers touristiques et rebattus. Ainsi que des routes trop balisées de sa propre existence... « Sous la plume avenante de Lauren Elkin, Venise n'a plus rien d'une ville-musée. Des vertus de l'errance pour faire connaissance avec soi-même. » Jeanne de Ménibus - ELLE « À la fois romance, enquête et découverte de soi, c'est une ¿uvre d'une douceur et d'une réalité superbes. » Lire
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.