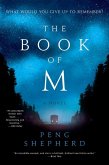Der Autor, dem Frankreich zu Füßen liegt
Dieser poetische Roman, Familiensaga und Abenteuergeschichte in der Tradition Joseph Conrads und R. L. Stevensons, führt auf eine kleine tropische Insel vor Mauritius im Indischen Ozean. Für die Brüder Jacques und Leon Archambau, deren ungewöhnliches Schicksal J. M. G. Le Clezio erzählt, ist die Insel Hölle und Paradies zugleich.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Dieser poetische Roman, Familiensaga und Abenteuergeschichte in der Tradition Joseph Conrads und R. L. Stevensons, führt auf eine kleine tropische Insel vor Mauritius im Indischen Ozean. Für die Brüder Jacques und Leon Archambau, deren ungewöhnliches Schicksal J. M. G. Le Clezio erzählt, ist die Insel Hölle und Paradies zugleich.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Abenteuerlich: J. M. G. Le Clézio möchte Rimbaud amputieren
In seinem neuen Roman schöpft Le Clézio aus mehreren längst tot geglaubten konventionellen Genres. Er ist zugleich Familienchronik, Seefahrergeschichte und Kolonialwarenroman mit stark parfümierter Inselexotik. Das hat nur stellenweise den Charme des Altmodischen und wird nach und nach zur belohnungsfreien Geduldsprobe. Erzählt wird die Geschichte der "fluchbeladenen" Familie Archambau, die auf der Insel Mauritius im Indischen Ozean Zuckerrohrplantagen besaß. Nach dem Bruch mit dem Patriarchen wird sie vom kolonialen Gut vertrieben und strandet in Paris, wo Mutter Amalia stirbt und die Söhne Léon und Jacques als bedauernswerte Waisen zurücklässt. Aus der Perspektive des Enkels von Jacques wird der erste Teil des Romans erzählt, der den gefährlichen Titel "Der Reisende ohne Ziel" trägt und den Leser in der Panik aufschrecken lässt, damit könnte der Romanautor selber gemeint sein.
Le Clézio verwendet den zugegeben schlauen Trick, dass er schon auf der ersten Seite erwähnt, besagter Großvater Jacques sei 1872 zum ersten Mal Rimbaud begegnet. Mit dieser lockenden Karotte vor der Nase strebt der Leser weiter vor ins Romanmassiv. Denn wer wollte nicht die Bahnen des Leitsterns der modernen Poesie kreuzen, der mit neunzehn das Dichten aufgab und ein vom Mysterium umwehtes Dasein als Händler und Waffenschieber am Horn von Afrika lebte? Der Enkel, eine Maske des Romanciers, ist ein regelrechter Literaturtourist, der das Paris unserer Tage auf den Spuren des "Rumtreibers Rimbaud" durchwandert und gern in der Welt herumjettet. Doch es bleibt bei der simpelsten Rimbaud-Schwärmerei, der Dichter mit den Windsohlen ist nur ein vages Sinnbild für Aufbruch und ewiges Unterwegssein.
Im Jahr 1891 brechen die Brüder Léon und Jacques an Bord der "Ava" nach Mauritius auf, um ihre "Heimat", ihren "Ursprung" zu suchen, "um sich zu erneuern, um sich am Himmel und am Meer zu verbrennen". In Aden treffen sie auf den schwer kranken Rimbaud, der mit einem amputationsreifen Bein auf das Schiff wartet, das ihn zum Sterben nach Marseille bringen wird. Jacques, der Arzt ist, bietet seine Hilfe an, Léon ist von dem Mann fasziniert. Über Rimbaud in Aden erfährt man aber nicht mehr, als in jedem französischen Schulbuch steht. Der Dichter dient eben nur als billiger Lockvogel.
Die Reise endet nicht in Mauritius, sondern vorerst auf der nahen Ile Plate (Flat Island), wo die Schiffspassagiere ihre Quarantäne absitzen müssen, denn an Bord sind die Pocken ausgebrochen. Die Insel wird von Indern bewohnt, mancherlei koloniale Konflikte brechen auf. Mal machen die Kulis Aufstand, mal brennt bei den Europäern etwas an. Le Clézio zelebriert Hunderte von Seiten lang hemmungslose Inselexotik. Der Klappentext schwärmt von Stevensons "Schatzinsel" und Joseph Conrad. Ein Delirium! Es handelt sich nur um weitgehend keimfreie Reisebüro-Prosa. Kein Detail zur Geologie der Insel, zu Ethnographie oder Botanik wird dem entnervten Leser verschwiegen. Jedes Pflänzchen, dessen Name der Botaniker John seinem Tagebuch anvertraut, wird aus der schriftstellernden Botanisierbüchse gezerrt. Nicht die Pockengefahr hängt drohend über diesen Seiten, sondern das viel banalere Leiden der tödlichen Langeweile.
Das Ganze ist aber nur Staffage für eine tropenheiße Liebesgeschichte. Léon streift über das Eiland und verliebt sich in das indische Mädchen Suryavati aus dem Pariadorf. Der Name der Schönen bedeutet "Kraft der Sonne", und Augen hat sie "wie Bernstein oder Topas". Der schwüle Kitsch dieser Romanze passt zum Tiefdruck-Klima des Romans: "Suryavatis Liebe ist glühend wie die Sonne, langsam und stark wie das Meer, wahr wie der Wind . . . Sie ist ich und ich bin sie, wir sind vereint in einer sehr starken und sehr sanften Bewegung. Und wir sind auch die schwarze Haut der Insel und der Wind und das Meer." Wer einen solchen Roman bis zum Schluss aushält, ist tatsächlich reif für die Insel. Die Quarantäne ist dann doch einmal zu Ende. Der verliebte Léon, das hausgemachte Rimbaud-Double, lässt seinen Bruder Jacques samt Schwägerin nach Mauritius weiterreisen und bleibt mit dem schwangeren Pariamädchen auf der Insel zurück. Er verzichtet auf seine europäische Vergangenheit und gilt fortan in der Kolonialfamilie als "der Verschollene".
Während der Lektüre beginnt man weniger über das permanente Evasionsbedürfnis gewisser Romanautoren zu sinnieren als über die durchaus wichtigere Frage, wie viel Lebenszeit man guten Gewissens einem langfädigen Roman schenken darf. Und auch darüber, dass gute Bücher einem diese Lebenszeit nicht rauben, sondern vervielfachen. Der Trick mit Rimbaud ist nicht nur schlau, sondern zweischneidig. Er richtet sich letztlich gegen den Romanautor selber. Rimbaud hat sich - durchtriebene Ironie des literarischen Ruhms - mit ein paar wenigen Dutzend atemberaubender Seiten in die Weltliteratur katapultiert, mit dem allerschmalsten literarischen Werk. Das macht einen beim Lesen des überdicken Romans eines 1940 geborenen Schriftstellers, der über dreißig dicke Bücher geschrieben hat, besonders nachdenklich.
RALPH DUTLI.
J. M. G. Le Clézio: "Ein Ort fernab der Welt". Roman. Aus dem Französischen übersetzt von Uli Wittmann. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2000. 576 Seiten, geb., 48,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main