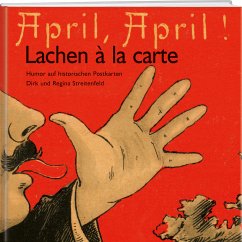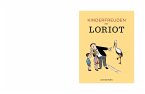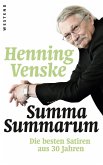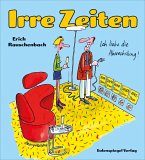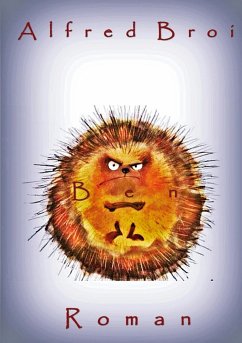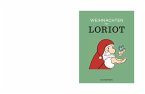Es gibt im deutschsprachigen Raum bisher kein Buch, das sich eingehend mit historischen Humorpostkarten befasst hat. Weder der Humorgehalt von Kartentexten noch die Gestaltungsvielfalt waren je Gegenstand einer bekannten Publikation. Bei der Aufarbeitung historischer Humorpostkarten findet man einen kulturellen Schatz vor, der bisher (warum auch immer) übersehen wurde. Wenn man bedenkt, dass es sich bei dieser Publikation um die Beschreibung der Kinderstube heutiger Bildmuster handelt, versteht man das publizistische Desinteresse umso weniger. Historische Humorpostkarten (ab ca. 1880) setzten allererste Visualisierungs-Standards für Anlässe und Ereignisse. Die Gestaltung heutiger Cartoons ist auf historischen Humorpostkarten vielfach angelegt - Denkanstösse und Gestaltungsanregungen für zeitgenössische Zeichner und Karikaturisten.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Auch im Schrecken liegt ein Kern der Komik. Nirgendwo ist das so deutlich zu sehen wie auf Humorpostkarten. Ein großes Konvolut davon ist jetzt für ein Buch zusammengetragen worden.
Postkarten sind im Gegensatz zum Brief eine Erfindung der Neuzeit, erstmals überhaupt zum Versand zugelassen 1869, als in Österreich die "Correspondenz-Karte" eingeführt wurde - zuvor war es undenkbar, eine schriftliche Nachricht unverhüllt der Post anzuvertrauen. Der Verzicht aufs Briefgeheimnis und die Beschränkung auf den kleinformatigen Kartonbogen schlugen sich in günstigerem Porto nieder, Schreibfaulen kam der knappe Platz zupass - nur die rückwärtige Seite stand für eigenen Text zur Verfügung, die vordere war Adressangaben vorbehalten. Das kam beim Publikum gut an, und der Norddeutsche Bund folgte dem österreichischen Vorbild ein Jahr später. Aus dem deutschen Sprachraum trat die Postkarte dann ihren Siegeszug um die ganze Welt an.
Bilder allerdings bot sie anfangs nicht, denn die hätten ja nur auf die Rückseite gedruckt werden können, weil neben den Adressen auf der Vorderseite nichts stehen durfte. Und auf die Bilder hätte man dann die eigentliche Mitteilung schreiben müssen. So geschah es dann bisweilen auch, seit 1885 in Deutschland ausdrücklich auch die Beförderung von Bildpostkarten erlaubt worden war. Damit war die Ansichtskarte geboren, und als sie immer prächtiger und raumgreifender ausgestaltet wurde, hatte selbst die Post ein Einsehen und gab im Jahr 1905 zusätzlich die halbe Fläche der Vorderseite für den Text frei. Der Postkartenverkehr schwoll mächtig an: Waren 1899 in Deutschland noch 88 Millionen befördert worden, waren es 1913 zwei Milliarden.
Von Beginn an waren die Karten auch beliebte Sammlerobjekte, und daraus resultierte ihre thematische Vielfalt. Besonders beliebt waren humoristische Motive. Und dabei vor allem anzügliche, die die gesellschaftlich normierte Biederkeit des neunzehnten Jahrhunderts genauso unterliefen wie Literatur oder Kunst, aber es noch offensichtlicher taten, weil die Bildpostkarte ja gerade öffentliche Mitteilung war. Die Drastik der Darstellungen machte nicht an politischen oder Mentalitätsgrenzen halt, wie die große Sammlung an historischen Humorpostkarten belegt, die Regina und Dirk Streitenfeld seit Mitte der siebziger Jahre zusammengetragen haben. Deren Herkunft ist gesamteuropäisch, und rund um das Sammlerehepaar hat sich in den letzten anderthalb Jahrzehnten ein Arbeitskreis aus Bildhistorikern formiert, der sich mit der Aufarbeitung der reichen Bestände beschäftigt.
Die Ergebnisse stellt jetzt ein Bildband namens "Lachen à la carte" vor (erschienen im Schweizer Verlag Werd & Weber). Es ist der erste seiner Art; auf 240 Seiten werden mehr als tausend Karten abgebildet, sortiert nach humoristischen Aspekten, wo nötig übersetzt (es gibt eine starke tschechische Gruppe) und um Aufsätze zur Post- und Witzgeschichte ergänzt. Aber das Lachen bleibt im Halse stecken, wenn man etwa Humorpostkarten aus dem Ersten Weltkrieg sieht, die sowohl auf chauvinistische Weise mit Entsetzen Scherz treiben als auch auf zynische. So sind etwa im Abschnitt "Essen und Trinken" deutsche Ansichtskarten mit Visionen üppiger Gelage aus den Hungerjahren der bis 1919 währenden alliierten Blockade zu finden - eine Form des Galgenhumors, die es schwer hatte, vor den Augen der Kriegszensur zu bestehen; die meisten dieser Karten sind denn auch "nicht gelaufen", also nie verschickt worden.
Galgenhumor ganz buchstäblicher Art findet sich auch, etwa auf einer technisch ausgefuchsten Bildpostkarte aus dem Frankreich der Jahrhundertwende, die den "Père 100" abbildet. Französische Soldaten pflegten hundert Tage vor Ablauf ihrer Wehrpflichtzeit eine Puppe anzufertigen, ebenjenen "Vater 100", und diese gemeinsam mit ihren Kameraden in effigie zu malträtieren: ein Stellvertreterakt der Widerspenstigkeit in der autoritären Organisation der Armee. Die gezeichnete Karte zeigt eine solche Strohpuppe am Galgen, auf ihrer heraushängenden Zunge steht "Ich hab's satt" geschrieben, und in den Augen kann man durch Drehscheiben die Zahl der noch verbliebenen Tage einstellen. Im guten wie im bösen Witz der Streitenfeld'schen Postkarten zeigt sich die ganze Kulturgeschichte der Menschheit.
ANDREAS PLATTHAUS
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main