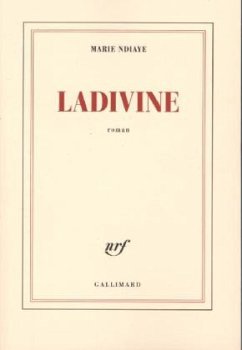Bloß wer zahlt die Rechnung? In ihrem Roman "Ladivine" erzählt Marie NDiaye von weiblichen Mängelgefühlen
Als Marie NDiaye neulich bei einer Lesung in Frankfurt gefragt wurde, warum in ihrem neuen Roman ausgerechnet Lüneburg eine so wichtige Rolle spiele, gab sie eine schöne, lapidare Antwort: wegen des Klangs. Sie sei noch nie in Lüneburg gewesen, sagte sie, aber der Name der Stadt habe ihr einfach gefallen.
Im Publikum sorgte diese Bemerkung für eine gewisse Heiterkeit. Es ist ja schön zu hören, dass Lüneburg offensichtlich in der Lage ist, in manchen französischen Ohren derart freundliche Assoziationen hervorzurufen. Wer mit dem Werk von Marie NDiaye aber ein wenig vertraut ist, der erkannte auch, dass sich hinter diesem kleinen Bekenntnis ein Hinweis auf das verbarg, wofür sich die französische Schriftstellerin schon immer interessiert hat, und zwar am allermeisten: für Stimmungen und atmosphärische Nuancen, für Dinge, die im Raum stehen, ohne gesagt worden zu sein, und auch für das, was diese Dinge in den Menschen bewirken.
Insofern mag Lüneburg tatsächlich gut in das Konzept von Marie NDiaye passen, deren neuer Roman "Ladivine" aber nicht nur dort, sondern auch in Bordeaux und Berlin, in Afrika und Annecy spielt. Das Buch variiert ein Thema, das bei dieser Autorin, die mit ihren gerade mal 46 Jahren schon ein gutes Dutzend Romane und mehrere Theaterstücke geschrieben hat, immer wieder auftaucht: Es geht um Menschen, die sich in ihren Leben wie Gäste fühlen, denen die Berechtigung für die eigene Existenz irgendwie abhanden gekommen ist oder ohnehin seit je her fehlt. Wie in dem mit dem Prix Goncourt ausgezeichneten Roman "Drei starke Frauen" (2010) und dem "Selbstporträt in Grün" (2011) sind es wieder vor allem weibliche Figuren, die sich diesen Mängelgefühlen zu stellen haben. Und sie tun dies auf mitunter radikale Weise. Malinka etwa, eine der vier Frauen, um die sich hier beinahe alles dreht, ist die Erste: Als Tochter einer dunkelhäutigen Putzfrau, die sie nur "die Dienerin" nennt, spürt sie früh das Bedürfnis, ihre Herkunft verleugnen zu müssen, um im Leben eine Chance zu haben. Sie nennt sich also Clarisse, heiratet, bekommt eine Tochter, wird aber weder Mann noch Kind jemals von der Existenz ihrer Mutter berichten und diesen Verrat irgendwann mit dem Leben bezahlen. Doch damit ist es nicht getan: Auch Clarisses Tochter Ladivine bekommt die Nachwirkungen dieser existentiellen Tragödie zu spüren, als sie mit ihrem deutschen, aus ebenjenem Lüneburg stammenden Ehemann eines Tages nach Afrika reist und dort bald begreift, dass sie das Land nicht als die verlassen kann, als die sie gekommen ist.
Ohne dass die Beteiligten je in der Lage wären, die Gründe für die Ereignisse klar zu benennen, sehen sie sich also Kräften ausgeliefert, deren Wirkungen sie sich nicht entziehen können. Zweifellos hat dabei eine allzu menschliche Schwäche ihre Hände oft im Spiel. Aber auch die Liebe, wie sie vor allem zwischen Eltern und Kindern besteht (auch dies übrigens ein Thema, dem sich Marie NDiaye gerne widmet), die Eifersucht, der Hass und die Rache liefern Motive, die leicht zu durchschauen, aber schwer nachvollziehbar und sowieso schwer beherrschbar sind. Marie NDiaye macht aus dieser Not eine Tugend: Sie nimmt konsequent die Innenperspektive ihrer Figuren ein, um deren Handlungen auf die Schliche zu kommen. Ihr Schreiben ähnelt in diesem Sinn einer Tiefenbohrung in die vielen Schichten der Gefühle. In diesen sehr feinen Beobachtungen von Hoffnungen und Enttäuschungen, Ausflüchten und Wahrheiten aber offenbart sich stets eine menschliche Ambivalenz, die jede Form des Zusammenlebens als ein Ausloten von Möglichkeiten begreift. Bei NDiaye geht es folglich nie um das, was oberflächlich getan oder gesagt wird, sondern immer um das, wofür Worte und Handlungen eigentlich stehen. Dass Worte und Taten auf der einen sowie Motive auf der anderen Seite selten einen Einklang bilden, ist hier die Annahme, die dem Geschehen als Triebfeder dient.
Das alles könnte nahelegen, dass die Autorin die Gelegenheit nutzt, um über ihre Figuren zu richten, oder wenigstens um zu zeigen, wie verloren sie sind. Aber das Gegenteil ist der Fall. Ihr Blick ist stets ergebnisoffen und ihre Sprache von einer Poesie geprägt, die sich dem Zynismus verweigert und stattdessen von tiefem Verständnis zeugt. Häufig erzählt Marie NDiaye von ihren Figuren im Rückblick. Sätze wie "Clarisse Rivière würde sich an die Monate nach Ladivines Geburt später als an eine Zeit großer Verstörung erinnern . . ." sind aber auch insofern typisch, als sie deutlich machen, dass es hier weniger um Absichten als mehr um Reaktionen geht. Trotz all der Kälte und Härte, welche die Personen zuweilen zeigen, nimmt der Leser sie deswegen meist als Opfer wahr. Und genau diese Perspektive erlaubt es uns auch, im hintersten Seelenwinkel vor allem von Malinka (alias Clarisse) die Ursache all des durch den Roman wabernden Bösen zu erkennen - nämlich einen unausgesprochenen, aber latenten Rassismus: "Es kam ihr vor, als habe sie von Anfang an, noch bevor sie verstehen und sprechen konnte, gewusst, dass Malinka und ihre Mutter für niemanden zählten, dass dies so war und man sich darüber nicht zu beklagen hatte, dass sie dunkle Blumen ohne Lebensberechtigung waren, dunkle Blumen." Marie NDiaye seziert ihre Figuren, aber sie verrät sie nie.
Umso schwieriger ist es indes zu verstehen, wieso sie offensichtlich glaubte, den Figuren so etwas wie Schutzengel mit auf ihre Wege geben zu müssen. Denn wie schon in mehreren Büchern lässt Marie NDiaye auch in "Ladivine" irgendwann (und relativ unvermittelt) sämtliche Gewissheiten zusammenbrechen, indem sie das Geschehen um eine weitere, surreal anmutende Dimension erweitert. Als Wegmarker dieser Erweiterung dienen ihr die Hunde - oft sind es zerrupft aussehende, knochige Tiere, die sich ihren Schutzbefohlenen immer dann zu erkennen geben, wenn bedeutende Veränderungen deren Leben schwer machen. Der realistische Rahmen, der die Erzählung umgibt, bricht in diesen Momenten aber regelmäßig zusammen, und dies provoziert ein Knirschen im Gebälk des Romans.
Anders als alles andere kann die Innenperspektive, die Marie NDiaye gewählt hat, den Einbruch des Märchenhaften und Phantastischen in das Geschehen nämlich nicht erklären. Darüber geraten aber nicht nur die Figuren, etwa Ladivine, ins Zweifeln ("Oder war sie es, Ladivine Rivière, die einen kranken Blick auf die Dinge richtete"). Auch der Roman selbst gerät unter der Last der ihm aufgebürdeten Phantasmagorie leicht ins Wanken. Dass er nicht in seine Einzelteile zerfällt, ist den hellwachen und messerscharfen Blicken zu verdanken, die Marie NDiaye immer wieder auf ihre Figuren wirft. Dass diese Blicke zuweilen hinter einen obskuren Schleier aus Zauberei zurücktreten müssen, ist indes ein Trick, auf den man hätte verzichten können.
LENA BOPP
Marie NDiaye: "Ladivine". Roman. Aus dem Französischen von Claudia Kalscheuer. Suhrkamp Verlag, Berlin 2014. 445 S., geb., 22,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main