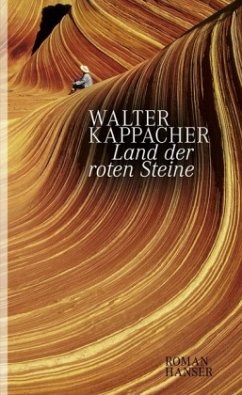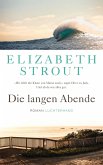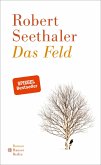Die Canyons in den USA: eine Welt voller Einsamkeit und Stille. Wessely, ein Arzt aus dem Salzburger Land, bricht in die Vereinigten Staaten auf, um im Alter über seine Zukunft nachzudenken. Mit Everett, dem wortkargen Fahrer des Jeeps, dringt er immer tiefer in eine Einsamkeit vor, in der er hofft, sich selbst zu finden. Doch findet man das erhoffte neue Leben, wenn man nur aus dem alten aufbricht? Walter Kappacher schreibt einen Roman, wie ihn heute keiner mehr schreiben kann: einen Roman, der ganz auf die Macht der Bilder und auf die Macht der Sprache vertraut, der Heimat und Fremde in eine überraschende und tiefe Beziehung setzt.

Was hat Walter Kappachers Held in Amerikas Canyons verloren? Sich selbst. Der Büchner-Preisträger geht auf eine kurze Odyssee.
Von Edo Reents
Der amerikanische Südwesten eignet sich als heimlicher oder sogar eigentlicher Westernheld deswegen so gut, weil er dem Personal, das sich in ihm bewegt, oder zumindest dem Zuschauer, der diesem dabei zusieht, Anlass für Überlegungen gibt, die über die menschliche Natur hinausgehen. Mit philosophischer Saloppheit könnte man es vielleicht so formulieren: In dieser Form von Geworfenheit ist der Mensch, ob nun Revolverheld oder Postkutscher, stärker als in, sagen wir, Nordkalifornien gezwungen, über so etwas wie Transzendenz nachzudenken. So verzapft er dann gewissermaßen Metaphysik und landet bei Schuld und Sühne, Gott und der Welt und am Ende - bei sich selbst. Das kann man anhand der John-Ford-Filme studieren, die oft im zerklüfteten Monument Valley an der Grenze zwischen Utah und Arizona spielen.
Was bedeutet es nun, wenn ein österreichischer Schriftsteller, der bisher durch ein gewisses Interesse an Angestellten-Existenzen aufgefallen ist und als einer der Stillen in deutschsprachigen Landen gilt, seinen Roman dort, ein wenig nach Norden verschoben, im Nationalpark Canyonlands spielen lässt? Bricht damit ein Stubenhocker aus, um seinem Protagonisten eine halsbrecherische Schlauchbootfahrt auf dem Colorado River zu gönnen? Walter Kappachers "Land der roten Steine" ist ein Abenteuerroman, der den touristischen Rahmen mit müheloser, subtiler Kraft sprengt; es ist ein Seelenabenteuerroman. Der Büchner-Preisträger von 2009 schickt einen an der Pensionsgrenze stehenden, verwitweten Allgemeinmediziner auf die Suche nach dem besseren oder überhaupt nach Leben, obwohl dieser Michael Wessely weit davon entfernt ist, sein früheres für vertan, sinnlos zu halten: "Sein bisheriges, erfülltes Leben - wie man so sagt - konnte und wollte er nicht einfach abschütteln, er hatte nichts zu bedauern oder zu bereuen."
Was nach einem Mangel an persönlicher Motivation aussieht, die sich konkreten Lebensumständen verdankte, verleiht dem abermaligen Aufbruch - insgesamt ist es der vierte - dieses kultivierten Arztes eine Triftigkeit, die sich dem Leser so richtig erst im letzten der drei auch in der Länge höchst unterschiedlichen Kapitel erschließt, die in Anspielung auf die antik-mittelalterliche humanistische Tradition den Sinn oder auch nur die Möglichkeit gelingenden, richtigen Lebens einzukreisen versuchen. Flüchtiger Lektüre mögen die Überschriften prätentiös erscheinen; in Wirklichkeit zeigen sie, dass Kappacher sich auf jeder Seite bewusst ist, in welche Tradition er sich damit stellt. Das Eingangskapitel "Vita nuova" mäandriert zwischen leise wehmütiger Lebensrückschau, in der Wessely sich über sein Verhältnis zur toten Ehefrau, zum toten Freund, zum dem Tode nahen Vater und zur unerreichbar fernen Tochter noch einmal Klarheit verschafft und dem Ausblick auf den neuerlichen amerikanischen Abstecher, für den das Wort "Reisefieber" natürlich zu hoch gegriffen ist. Dieser Mensch fiebert nicht, das hat er mit seinen Seelenverwandten aus dem Genazino-Kosmos gemein. Aber trauern tut er auch nicht, das unterscheidet ihn dann doch wieder vom Personal des anderen, Kappacher in vielem tatsächlich verwandten Büchner-Preisträgers.
Im zweiten, "De vita beata" überschriebenen Kapitel, das mit einem erzählerischen Perspektivwechsel einsetzt und weit mehr als die Hälfte des Romans ausmacht, ist Wessely dann mitten hineingeworfen in die Canyonlands. Der Leser sollte wissen, dass es nicht nur dem Protagonisten erhebliche Anstrengungen abverlangt. Endlos zieht sich die Wanderschaft hin, die Wessely unter der kundigen Führung des Navajo-Abkömmlings Everett Kish absolviert, der natürlich für eine gehörige Prise Zivilisationskritik sorgt.
Wie manisch ruft der Ich-Erzähler all die Felsen, Berge, Landstriche und Orte auf, die, wie bei einer Odyssee, immer wieder in den Blick kommen und verschwinden, um dann aufs Neue aufzutauchen. Aber der Erzähler geht hier selbstironisch in die Offensive, indem er über einen Fußmarsch sagt, was auch für dessen Lektüre gelten könnte: Die Strecke sei "langweilig, stundenlang immer bloß durch eine Steppenlandschaft". Man kommt da als Leser desto besser durch, je eher man merkt, was der Erzähler eigentlich will: die rotbraune Landschaft wirklich begreifen, vor allem in ihrer zeitlichen Dimension. Immer wieder wird das Alter der Canyonlands aufgerufen, die sich in Hunderten von Millionen Jahren zu ihrer gegenwärtigen Ausprägung herangebildet haben. Fast kommt einem dabei das horazische "Dauerhafter als Erz" in den Sinn, das hier gleichsam seine poetologische Umsetzung erfährt. In der Pedanterie des Erzählens spiegelt sich das persönliche Erleben, das ohne Fotoapparat auskommt. Die Begleitung durch den Indianer bringt natürlich Zivilisationskritik mit sich, in der gleichsam die Ewigkeit der Landschaft kontrastiert wird mit der gesellschaftlichen Beschleunigung, die dem Navajo so zu schaffen macht. Auch so verliert sich der Mensch in grandioser Kulisse, um dann aber eine erkenntnistheoretische Aufwertung zu erfahren, die der Reisende mit Meister Eckhart formuliert: "In meiner Geburt wurden alle Dinge geboren." Die Welt entsteht erst, indem sie erkannt wird - das ist philosophiegeschichtlich keine brisante Mitteilung, dient aber hier dazu, den Erzähler am Ende bei sich selbst ankommen zu lassen.
So breitet das letzte, mit Abstand lesenswerteste Kapitel "La vita breve" die für sich banale Erkenntnis, dass auch die interessante Reise den Menschen nicht grundlegend verändert, mit psychologischer Meisterschaft aus. Wessely macht, sanft in der Schwebe gehalten zwischen Ruhestandsresignation und vorsichtigem Ausblick auf das, was noch kommen mag, seinen Frieden mit sich und der Welt.
Walter Kappacher ist bekannt für sogenannte stille Bücher. Mit diesem bleibt er sich treu - zum Leserglück.
Walter Kappacher: "Land der roten Steine". Roman.
Hanser Verlag, München 2012. 160 S., geb., 17,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Die Geschichte eines Arztes, der sein Leben lang unglücklich war, nicht sein Leben lebte, sondern neben sich stand und den Eindruck hat, das Leben eines anderen gelebt zu haben, eines alternden Mannes, der nicht liebte und nicht hasste und davon träumte, Schriftsteller zu sein, was aber nicht heißt, das ihm die Sprache wirklich zu Gebote stünde. Gabriele Killert ist begeistert! Kappacher scheint hier eine Anleitung zur Melancholie in unserer vergreisenden Gesellschaft geschrieben zu haben, und Killert findet nicht genug lobende Worte für die Kargheit und Metaphernscheu seiner Sprache. Sie liest darin vor allem eins: Kappachers Romane lägen fern unserer so verdrießlichen "Welt der Pleonexie, sprich der Anmaßung, Gier, Trivialität". Und macht es Spaß, den Roman zu lesen? Na, zumindest der Rezensentin.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Dieser leise, aber dafür umso eindringlichere Österreicher des Jahrgangs 1938 also, er hat mit 'Land der roten Steine' vielleicht den wichtigsten deutschsprachigen Roman dieses Frühjahrs geschrieben. Einen Roman, der die Sehnsucht nach dem sinnerfüllten (neuen) Leben, nach der Umkehr, ernst nimmt." Tilman Krause, Die Welt, 04.02.12
"Walter Kappacher ist bekannt für sogenannte stille Bücher. Mit diesem bleibt er sich treu - zum Leserglück." Edo Reents, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.03.12
"Ein stiller, beeindruckender und sehr österreichischer Roman." Christoph Schröder, Frankfurter Rundschau, 22.02.12
"In seinem neuen Roman 'Land der roten Steine' schreibt Walter Kappacher mit stilistischem Raffinement über die Wunder der Canyonlands." Andreas Isenschmid, NZZ am Sonntag, 01.04.12
"Mit 'Land der roten Steine' ist dem Österreicher Walter Kappacher ein stiller, lebensernster Roman gelungen. (...) Mit Wessely hat Walter Kappacher wieder einen empfindsamen, geistig anspruchsvollen Romanhelden geschaffen, den in den Weiten des Canyonlands ein Hauch von Ewigkeit, vom großen All oder Nichts anweht." Gabriele Killert, Die Zeit, 31.05.12
"Kappacher gelingt ein durchaus ironisch grundiertes Buch über die großen Seinsfragen" Timo Schmeltzle, Die Rheinpfalz, 20.04.12
"Walter Kappacher ist bekannt für sogenannte stille Bücher. Mit diesem bleibt er sich treu - zum Leserglück." Edo Reents, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.03.12
"Ein stiller, beeindruckender und sehr österreichischer Roman." Christoph Schröder, Frankfurter Rundschau, 22.02.12
"In seinem neuen Roman 'Land der roten Steine' schreibt Walter Kappacher mit stilistischem Raffinement über die Wunder der Canyonlands." Andreas Isenschmid, NZZ am Sonntag, 01.04.12
"Mit 'Land der roten Steine' ist dem Österreicher Walter Kappacher ein stiller, lebensernster Roman gelungen. (...) Mit Wessely hat Walter Kappacher wieder einen empfindsamen, geistig anspruchsvollen Romanhelden geschaffen, den in den Weiten des Canyonlands ein Hauch von Ewigkeit, vom großen All oder Nichts anweht." Gabriele Killert, Die Zeit, 31.05.12
"Kappacher gelingt ein durchaus ironisch grundiertes Buch über die großen Seinsfragen" Timo Schmeltzle, Die Rheinpfalz, 20.04.12