Christoph Hein erzählt die Lebensgeschichte Bernhard Habers über fast 50 Jahre aus der Sicht und mit den Stimmen von fünf Wegbegleitern. Es ist der Lebenslauf eines Außenseiters in der Provinz, der mit der großen Geschichte scheinbar nichts zu tun hat und doch ihren Verlauf von der Nachkriegszeit bis zur Jahrtausendwende exemplarisch spiegelt.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Mit einiger Bewegung, aber nicht wirklich zufrieden beschreibt Rezensent Hubert Spiegel das Szenario dieses Romans, in dem er fünfzig Jahre deutscher Geschichte an einem ostdeutschen Städtchen vorüberziehen sieht: Kriegsende, Flucht, Hass auf Umsiedler, Mauerbau, Zusammenbruch der DDR und Wiedervereinigung. Den Held des Romans beschreibt Spiegel als "mürrischen Agenten der Anpassung", in dessen Brust er allerdings "ein Fünkchen Michael Kohlhaas" glühen sieht. Auch diesmal gelte Christoph Heins Hauptinteresse dem Formenreichtum der Deformation seiner Figuren, ihrem Wechselspiel mit dem "Akt der Selbstbehauptung". Fünf verschiedene Erzähler lasse Hein berichten, was im Städtchen Guldenburg geschah. Der Rezensent sieht sie auf 350 Seiten die Jahrzehnte durchwandern, zwischen individueller Biografie und Historie. Die dramaturgische Klammer, die Hein seinem Roman verordnet habe, um die verschiedenen Stimmen zusammenzuhalten, sei ganze zehn Seiten lang, merkt Spiegel mit dezentem Unbehagen an, dass sich angesichts des Fehlens einer politischen Perspektive noch vertieft. Hier nämlich empfindet er eine irritierende Leerstelle, die für ihn letztlich auch den Erzählfluss "einsilbig", den Roman insgesamt "seltsam diffus" wirken lässt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Christoph Hein stellt "Landnahme" im Frankfurter Schauspiel vor
Das Vorlesen macht ihm Spaß. Im überfüllten Kleinen Haus des Frankfurter Schauspiels konnte das Publikum jetzt erleben, wie sich ein Schriftsteller sichtlich und hörbar am eigenen Text erfreute. Christoph Hein bewies, daß er nicht nur ein Meister der Rollenprosa, sondern auch des Rollensprechens ist. Mit seinem kurz angebundenen Stakkato-Humor riß er seine Zuhörer immer wieder zu Beifallsstürmen hin. Auf der Bühne blüht er auf - schließlich hatte er seine Karriere 1963 begonnen: bei Benno Besson, der ihn damals auch gelegentlich als Schauspieler einsetzte, bevor Hein zum Hausautor der Ostberliner Volksbühne wurde. Diesmal trat der Schriftsteller in eigener Sache auf. Frankfurt war die vierte Station seiner triumphalen Lesereise mit seinem jüngsten Roman.
Unter dem Titel "Landnahme" ist das Buch bei Suhrkamp erschienen. Verlegerin Ulla Unseld-Berkéwicz stellte den Schriftsteller, den der Luchterhand Verlag 1983 als "Kultautor der DDR" entdeckt hatte, denn auch als Freund Siegfried Unselds vor. Der Suhrkamp-Verleger hatte lange um Hein geworben. Aber erst vor vier Jahren war dieser mit seinem Roman "Willenbrock" zu Suhrkamp umgesiedelt, wo inzwischen sein Gesamtwerk betreut wird. Nach Richard von Weizsäcker, Jutta Limbach und Peter Turrini führte diesmal Frank Schirrmacher, Feuilleton-Herausgeber dieser Zeitung, in das Werk des Schriftstellers ein. Er hob die "Entemotionalisierung" der Sprache des Verfassers sowie den Humor in diesem Buch über die Leiden der Vertreibung und Assimilation hervor.
Die klassische Einfachheit seiner Sprache weist Hein tatsächlich als den Suhrkamp-Autor aus, für den Unseld ihn gehalten hatte. Die Rollenprosa, mit der er sich 1982 in seiner Novelle "Der fremde Freund" ("Drachenblut") einen Namen gemacht hatte, ist und bleibt seine Spezialität. Fünf Personen erzählen von Bernhard Haber, der nach dem Krieg als Vertriebener mit seinen Eltern von Schlesien ins sächsische Städtchen Bad Guldenberg kommt und sich dort, allen kleinbürgerlichen Demütigungen und sozialistischen Realitäten, trotzend zum erfolgreichen Unternehmer entwickelt. Das geht nicht ohne ein Opfer, und dieses Opfer hat Schirrmacher in Umkehrung jüdisch-christlicher Tradition in dem ermordeten Vater des Protagonisten ausgemacht. Muß die "schuldige Vaterwelt" also erst ausgelöscht werden, damit Haber wieder heimisch werden kann? Der Text legt diese Lesart zumindest nahe.
Ungewiß bleibt, ob dies die "Landnahme" ist, auf die sich der Titel des Buchs bezieht. Hein hält sich wie immer bedeckt. "Wir wissen nicht, wozu er gehört, worauf er schwört", sagte Schirrmacher. Was wir aber wissen, ist, daß er einen wunderbar trockenen Humor hat, eine Mischung aus Berliner Unverfrorenheit und angelsächsischem Understatement. Wohl nicht zufällig, sondern zu seinem eigenen und zum Vergnügen des Publikums las der Autor gleich zwei Passagen aus dem vorletzten der fünf Kapitel, in dem sich Habers Schwägerin Katharina Hollenbach daran erinnert, wie sie einst den Freund ihrer prüden Schwester getröstet hatte: ein Schelmenstück, eine Eulenspiegelei im biederen Alltag einer Republik, in der alles seinen sozialistischen Gang gehen durfte, sofern es der oligarchische Kegelverein des Ortes zuließ.
CLAUDIA SCHÜLKE
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

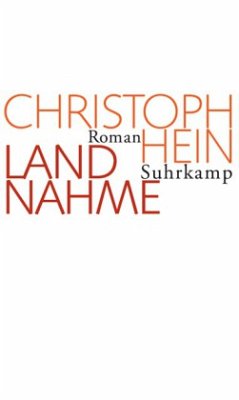
heike-s.jpg)