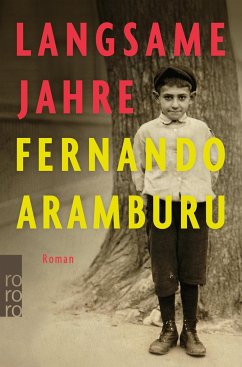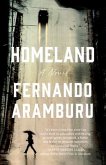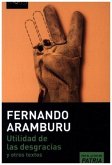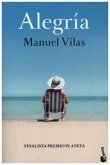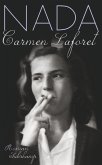Ein achtjähriger Junge wird von seinen Eltern zu Verwandten geschickt, sie selbst können ihn nicht mehr ernähren. In San Sebastián erwartet ihn eine typisch baskische Familie der sechziger Jahre: Die Tante hat das Sagen, ihr Mann kriegt den Mund nicht auf. Die Cousine und der Cousin suchen auf verschiedene Weisen neue Freiheiten, von denen die Eltern nichts wissen. Der Junge beobachtet mit den staunenden Augen eines Kindes, wie mühevoll es ist, seinen eigenen Weg zu finden. Doch als er seine Chance bekommt, nutzt er sie.
Ein berührender Roman über das Schicksal einer Familie, der einem zu Herzen geht und gleichzeitig viel darüber erzählt, wie wir zu dem werden, was wir sind.
Ein berührender Roman über das Schicksal einer Familie, der einem zu Herzen geht und gleichzeitig viel darüber erzählt, wie wir zu dem werden, was wir sind.
Ein großartiger und zutiefst poetischer Roman. Peter Helling NDR 20190701

Fernando Aramburu erzählt aus der Frühzeit der Eta
"Langsame Jahre", der Roman von Fernando Aramburu, der soeben in der Übersetzung von Willi Zurbrüggen auf Deutsch erschienen ist, hat die Anmutung eines Kammerspiels. Kaum je verlässt der Erzählstrang die Räumlichkeiten der Familie in San Sebastián. Und doch ist die Prosa so dicht und als Vexierspiel so komplex angelegt, dass der schmale Roman, der im Original bereits 2012 erschienen ist, viel mehr ist als eine Vorstudie zu Aramburus gefeiertem Großroman "Patria" von 2016. Auch "Langsame Jahre" umkreist den baskischen Befreiungskampf der Eta. Die "Euskadi Ta Askatasuna", zu Deutsch "Baskenland und Freiheit", wie sich die separatistische Untergrundorganisation bis zu ihrer Selbstauflösung 2018 nannte, hatte sich 1959 im Widerstand gegen Franco gegründet und den Terror als Mittel zur Durchsetzung der erstrebten Loslösung von Spanien gewählt. Ihren ersten Mord verübte sie 1960 - und in den sechziger Jahren siedelt Aramburu seine Geschichte an.
"Langsame Jahre" erzählt einerseits von einem achtjährigen Jungen, dessen Mutter so arm ist, dass sie ihn in die Obhut von Verwandten in der Stadt geben muss. So brüsk der ältere Cousin Julen sich anfangs gegenüber dem neuen Familienmitglied aufspielt, so vertraut wird die Beziehung der beiden im Laufe der Zeit, vor allem, als Julen sich heimlich den Revolutionären anschließt und erst in Schwierigkeiten gerät und schließlich nach Frankreich fliehen muss. Es geht um Ehre und um Patriotismus, um Katholizismus, Sexualität, um Familie, Fehltritte, Scham und möglichen Verrat.
Was die Prosa auszeichnet, sind die verschiedenen Zugänge zu der Geschichte. Denn zum einen lässt Aramburu aus der Rückschau von mehr als fünf Jahrzehnten den Jungen von damals auf die Ereignisse seiner Kindheit blicken. Er ist der Ich-Erzähler, der sich erinnert - und dies einem Schriftsteller namens Aramburu berichtet. Zum zweiten lesen wir in einem parallelen Strang die Notate des Autors im Flattersatz, der sich aus dem gerade Gehörten wiederum seinen eigenen Reim macht. Es sind tatsächlich nicht mehr als Stichworte, literarisch unausgearbeitet, allenfalls als Gedankenstützen gemeint. So aber werden wir mitunter über dieselben Ereignisse mehrfach informiert, durch eine nicht immer zuverlässige Erinnerung sowie durch die mit Kommentaren und Fragen versehenen Notizen, die schon auf die spätere Verwertung abzielen: "Die Beschreibung zweitrangiger Figuren besser nicht allzu ausführlich. Vorsicht mit verräterischen Einzelheiten. Die Tapete um die Steckdose herum von einem Kurzschluss schwarz verbrannt."
Während der 800-Seiten-Roman "Patria" horizontal und über einen Zeitraum von zwei Jahrzehnten von der Eta erzählt, stellt "Langsame Jahre" drei Figuren ins Zentrum eines Sommers. Es ist eine eindringliche Studie über baskische Verhältnisse, eine Region mithin, der sich die Literatur nicht eben häufig zuwendet. Es ist eine Auseinandersetzung mit den Anfängen von Gewalt und dem schmalen Grat zwischen Anliegen und Irrweg - und nicht zuletzt auch damit, wie daraus literarisch Profit zu schlagen ist.
SANDRA KEGEL
Fernando Aramburu:
"Langsame Jahre". Roman.
Aus dem Spanischen von Willi Zurbrüggen. Rowohlt Verlag, Hamburg 2019. 208 S., geb., 20,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Keine erklärenden Passagen, Freundchen
Der Roman „Langsame Jahre“ von Fernando Aramburu liest sich wie eine Vorstudie zu dem Welterfolg „Patria“
„Nie hörte ich ihn den Namen Eta erwähnen“, erinnert sich Txiki an seinen Cousin Julen. Er war kaum acht Jahre alt, als ihn seine Mutter nach San Sebastián schickte, zu seiner Tante und deren Familie, damit diese ihn durchfüttern. Der damals gut doppelt so alte Julen muss fortan das Zimmer mit ihm teilen. Doch weil Txiki sein Vertrauen gewinnt, wird er spätnachts, wenn der Cousin nach Hause kommt, mit unausgegorenen, hitzköpfigen Ideen bedrängt, auf die er sich noch keinen Reim machen kann. Tagsüber arbeitet Julen in einer Brauerei, nachts zieht er mit Freunden durch die Bars oder treibt Dinge, die im Dunkeln bleiben. „Ich hatte nicht die geringste Ahnung“, erinnert sich Txiki, „dass mein Cousin Julen zu jener Zeit bis zum Hals in politische Untergrundaktionen verstrickt war.“ Unter Julens Matratze versteckt liegt die baskische Fahne.
„Langsame Jahre“ heißt der neue Roman von Fernando Aramburu, weil unter einer Diktatur wie derjenigen von Franco die Zeit langsamer vergeht als unter einer demokratischen Regierung, eine Minute also, wie Aramburu behauptet, anderthalb oder zwei Minuten dauert. So neu jedoch ist der Roman auch wieder nicht, das Original kam bereits im Jahr 2012 heraus, vor „Patria“, der großen Familiensaga über den gewaltsamen Konflikt im Baskenland, über Opfer und Täter der Eta. Weil „Patria“ ein so sensationeller Erfolg geworden ist, von der Presse gefeiert, mit Preisen bedacht und allein in Deutschland, wo der Roman letztes Jahr erschienen ist, mehr als fünfzigtausend Mal verkauft, ging unzähligen Verlagen in der Welt auf, dass ein Autor von sechzig Jahren auch schon früher Bücher geschrieben haben könnte, die sie dem Publikum nicht vorenthalten wollen.
Der auf einer baskischen Fahne schlafende Julen hat einiges gemeinsam mit Joxe Mari, der sich in „Patria“ dem bewaffneten Kampf anschließt und später im Gefängnis schier verzweifelt an der Nachricht, dass die Eta aufgibt und ihre Waffen streckt. Nur dass Julen gerade noch davonkommt, wie genau erfährt man nicht, aber es könnte gut sein, dass er sich, wie Joxe Mari nach Frankreich geflohen und mit den erbärmlichen Umständen eines Flüchtigen konfrontiert, auf eine Kooperation mit Francos Schergen eingelassen hat, auf eine Polizei, die jede Information begierig aufgreift und zum Dank eine Rückkehr in Freiheit verspricht. Zurück in San Sebastián sieht er sich als „schlechter Baske“ gebrandmarkt, keiner will mehr etwas mit ihm zu tun haben, die ganze Familie wird geschnitten. Vielleicht aber hat er gar nichts verraten, alles nur Gerüchte, vielleicht hat er nur dem Kampf abgeschworen. Selbst das aber scheint eine nationalistisch gestimmte Bevölkerung nicht zu verzeihen. Ihm wird klar, dass er in seinem geliebten Baskenland keine Zukunft mehr hat.
Auch die Familie, aus der Julen stammt, ähnelt der Familie des Joxe Mari in „Patria“. Ein schwacher Vater, der den Ereignissen tatenlos zusieht, aber alle ernährt durch seine Arbeit in der Seifenfabrik; eine starke Mutter, die ihren Sohn selbst im Irrtum nach Kräften unterstützt, stolz und von Argumenten nicht zu überzeugen, ein wenig furchteinflößend. Als sie mit einer polizeilichen Durchsuchung rechnet, putzt sie die Wohnung heraus und stellt da und dort religiöse Gegenstände auf, auch die Gipsfigur eines Legionärs neben einem Fahnenmast mit einer nicht baskischen, sondern spanischen Fahne. Die Polizisten verwüsten die Wohnung trotzdem.
Über das Verhältnis der Kinder zueinander, der Geschwister Julen und Mari Nieves, verliert Aramburu nicht viele Worte. Zwar reden sie nie miteinander, aber zerstritten sind sie auch nicht, „sie hatten nur von klein auf eine Beziehung zueinander wie zwei Bäume, die einer neben dem anderen wachsen“. Julen bildet einen Strang der Handlung, Mari Nieves den anderen. Beide wollen raus aus der sie behütenden, aber auch einschnürenden Arbeiterfamilie. Mari Nieves ist keine Schönheit, aber da sie jung ist, kann sie eigentlich jeden haben. Txiki beobachtet sie dabei, wie sie sich lustvoll eine Handvoll Weintrauben in den Mund stopft. Irgendwann ist sie schwanger, aber keiner der drei in Frage kommenden Männer will sie heiraten. Das Baby kommt behindert auf die Welt, worauf Julen eine Äußerung entfährt, die den in ihm lauernden Brutalo verrät, wie geschaffen für die Eta: „Ich hätte das in zehn Sekunden für immer erledigt, und niemand würde was merken.“
Aramburu hat einen Roman geschrieben, der so tut, als wäre er noch kein Roman, vielmehr literarische Werkstatt und Materialsammlung. Txikis Erinnerungen, teils mündlich, teils schriftlich mitgeteilt, sind die wichtigste fiktive Quelle. Die Figur, inzwischen gereift und längst Familienvater, ist genauso alt wie ihr Autor. Das trifft sich gut, da Aramburu über Menschen schreiben will, die ihm aus der eigenen Kindheit in San Sebastián vertraut sind, einfache Menschen in einem Arbeiterviertel. Angeblich traf er damals im Bus auf Julens Vater, ohne dessen Gruß zu erwidern, angeblich hatte er sich anstecken lassen von der Verachtung gegenüber Julen und dessen Familie. Insofern wäre dieser Roman auch von persönlicher Scham inspiriert.
Immer wieder unterbrochen wird Txikis Bericht durch Notate des Autors im Flattersatz. Entwürfe für Kapitel, vorläufige Dialoge, Fragen, die noch zu klären sind. „Wenn du willst“, schlägt ein lüsterner Elektriker der attraktiven Tante vor, „kannst du in Naturalien bezahlen.“ Dazu der Autor: „Der Ausdruck ist vielleicht etwas zu gesucht für diese Sorte von Leuten. Über einen weniger literarisch geprägten Ausdruck nachdenken. Ich könnte meine Mutter fragen. Wenn sie ihn kennt, lasse ich ihn.“ Leider verfolgt Aramburu dieses Konzept der Notate nicht konsequent. Er fängt an zu kokettieren und zu kommentieren, er schielt also auf seine Leser, die er mit einem Roman und eben nicht mit einer Romanwerkstatt beglücken will: „Hören Sie, Herr Schriftsteller, ein bisschen Respekt für Ihre Figuren!“ oder „Keine erklärenden Passagen, Freundchen. Oder hast du vergessen, dass du für Erwachsene schreibst?“ Jaja, wie witzig. Welcher Schriftsteller würde so einen Schmarren für ein Romanprojekt notieren? Ein paar Streichungen, und alles wäre in Ordnung. Aber offenbar wollte Aramburu diese Streichungen nicht haben.
Davon unberührt bleibt Julens Geschichte Ende der Sechzigerjahre, das schleichende Abgleiten in die Fänge der Eta. Nach einem politischen Mord verhängt das Franco-Regime den Ausnahmezustand über die Region, mit der Folge von willkürlichen Verhaftungen, Razzien, Prügeln in den Kellern der Polizeiwachen. Und doch wird das alles auf den vielen hundert Seiten von „Patria“, dem überragenden Roman von Fernando Aramburu, stärker, widersprüchlicher, ergreifender erzählt. „Langsame Jahre“ ist nicht mehr als das Vorspiel dazu, aber eines, das erkennen lässt, wie sich ein Schriftsteller auf den großen Wurf vorbereitet. So ist es, Freundchen, glaub mir, und so ist es gut.
RALPH HAMMERTHALER
Fernando Aramburu: Langsame Jahre. Roman. Aus dem Spanischen von Willi Zurbrüggen. Rowohlt Verlag, Hamburg 2019. 208 Seiten, 20 Euro.
Der Text wird immer wieder
unterbrochen von
Anmerkungen des Autors
Fernando Aramburu, geboren 1959 in San Sebastián.
Foto: afp / Bertrand Guay
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
Der Roman „Langsame Jahre“ von Fernando Aramburu liest sich wie eine Vorstudie zu dem Welterfolg „Patria“
„Nie hörte ich ihn den Namen Eta erwähnen“, erinnert sich Txiki an seinen Cousin Julen. Er war kaum acht Jahre alt, als ihn seine Mutter nach San Sebastián schickte, zu seiner Tante und deren Familie, damit diese ihn durchfüttern. Der damals gut doppelt so alte Julen muss fortan das Zimmer mit ihm teilen. Doch weil Txiki sein Vertrauen gewinnt, wird er spätnachts, wenn der Cousin nach Hause kommt, mit unausgegorenen, hitzköpfigen Ideen bedrängt, auf die er sich noch keinen Reim machen kann. Tagsüber arbeitet Julen in einer Brauerei, nachts zieht er mit Freunden durch die Bars oder treibt Dinge, die im Dunkeln bleiben. „Ich hatte nicht die geringste Ahnung“, erinnert sich Txiki, „dass mein Cousin Julen zu jener Zeit bis zum Hals in politische Untergrundaktionen verstrickt war.“ Unter Julens Matratze versteckt liegt die baskische Fahne.
„Langsame Jahre“ heißt der neue Roman von Fernando Aramburu, weil unter einer Diktatur wie derjenigen von Franco die Zeit langsamer vergeht als unter einer demokratischen Regierung, eine Minute also, wie Aramburu behauptet, anderthalb oder zwei Minuten dauert. So neu jedoch ist der Roman auch wieder nicht, das Original kam bereits im Jahr 2012 heraus, vor „Patria“, der großen Familiensaga über den gewaltsamen Konflikt im Baskenland, über Opfer und Täter der Eta. Weil „Patria“ ein so sensationeller Erfolg geworden ist, von der Presse gefeiert, mit Preisen bedacht und allein in Deutschland, wo der Roman letztes Jahr erschienen ist, mehr als fünfzigtausend Mal verkauft, ging unzähligen Verlagen in der Welt auf, dass ein Autor von sechzig Jahren auch schon früher Bücher geschrieben haben könnte, die sie dem Publikum nicht vorenthalten wollen.
Der auf einer baskischen Fahne schlafende Julen hat einiges gemeinsam mit Joxe Mari, der sich in „Patria“ dem bewaffneten Kampf anschließt und später im Gefängnis schier verzweifelt an der Nachricht, dass die Eta aufgibt und ihre Waffen streckt. Nur dass Julen gerade noch davonkommt, wie genau erfährt man nicht, aber es könnte gut sein, dass er sich, wie Joxe Mari nach Frankreich geflohen und mit den erbärmlichen Umständen eines Flüchtigen konfrontiert, auf eine Kooperation mit Francos Schergen eingelassen hat, auf eine Polizei, die jede Information begierig aufgreift und zum Dank eine Rückkehr in Freiheit verspricht. Zurück in San Sebastián sieht er sich als „schlechter Baske“ gebrandmarkt, keiner will mehr etwas mit ihm zu tun haben, die ganze Familie wird geschnitten. Vielleicht aber hat er gar nichts verraten, alles nur Gerüchte, vielleicht hat er nur dem Kampf abgeschworen. Selbst das aber scheint eine nationalistisch gestimmte Bevölkerung nicht zu verzeihen. Ihm wird klar, dass er in seinem geliebten Baskenland keine Zukunft mehr hat.
Auch die Familie, aus der Julen stammt, ähnelt der Familie des Joxe Mari in „Patria“. Ein schwacher Vater, der den Ereignissen tatenlos zusieht, aber alle ernährt durch seine Arbeit in der Seifenfabrik; eine starke Mutter, die ihren Sohn selbst im Irrtum nach Kräften unterstützt, stolz und von Argumenten nicht zu überzeugen, ein wenig furchteinflößend. Als sie mit einer polizeilichen Durchsuchung rechnet, putzt sie die Wohnung heraus und stellt da und dort religiöse Gegenstände auf, auch die Gipsfigur eines Legionärs neben einem Fahnenmast mit einer nicht baskischen, sondern spanischen Fahne. Die Polizisten verwüsten die Wohnung trotzdem.
Über das Verhältnis der Kinder zueinander, der Geschwister Julen und Mari Nieves, verliert Aramburu nicht viele Worte. Zwar reden sie nie miteinander, aber zerstritten sind sie auch nicht, „sie hatten nur von klein auf eine Beziehung zueinander wie zwei Bäume, die einer neben dem anderen wachsen“. Julen bildet einen Strang der Handlung, Mari Nieves den anderen. Beide wollen raus aus der sie behütenden, aber auch einschnürenden Arbeiterfamilie. Mari Nieves ist keine Schönheit, aber da sie jung ist, kann sie eigentlich jeden haben. Txiki beobachtet sie dabei, wie sie sich lustvoll eine Handvoll Weintrauben in den Mund stopft. Irgendwann ist sie schwanger, aber keiner der drei in Frage kommenden Männer will sie heiraten. Das Baby kommt behindert auf die Welt, worauf Julen eine Äußerung entfährt, die den in ihm lauernden Brutalo verrät, wie geschaffen für die Eta: „Ich hätte das in zehn Sekunden für immer erledigt, und niemand würde was merken.“
Aramburu hat einen Roman geschrieben, der so tut, als wäre er noch kein Roman, vielmehr literarische Werkstatt und Materialsammlung. Txikis Erinnerungen, teils mündlich, teils schriftlich mitgeteilt, sind die wichtigste fiktive Quelle. Die Figur, inzwischen gereift und längst Familienvater, ist genauso alt wie ihr Autor. Das trifft sich gut, da Aramburu über Menschen schreiben will, die ihm aus der eigenen Kindheit in San Sebastián vertraut sind, einfache Menschen in einem Arbeiterviertel. Angeblich traf er damals im Bus auf Julens Vater, ohne dessen Gruß zu erwidern, angeblich hatte er sich anstecken lassen von der Verachtung gegenüber Julen und dessen Familie. Insofern wäre dieser Roman auch von persönlicher Scham inspiriert.
Immer wieder unterbrochen wird Txikis Bericht durch Notate des Autors im Flattersatz. Entwürfe für Kapitel, vorläufige Dialoge, Fragen, die noch zu klären sind. „Wenn du willst“, schlägt ein lüsterner Elektriker der attraktiven Tante vor, „kannst du in Naturalien bezahlen.“ Dazu der Autor: „Der Ausdruck ist vielleicht etwas zu gesucht für diese Sorte von Leuten. Über einen weniger literarisch geprägten Ausdruck nachdenken. Ich könnte meine Mutter fragen. Wenn sie ihn kennt, lasse ich ihn.“ Leider verfolgt Aramburu dieses Konzept der Notate nicht konsequent. Er fängt an zu kokettieren und zu kommentieren, er schielt also auf seine Leser, die er mit einem Roman und eben nicht mit einer Romanwerkstatt beglücken will: „Hören Sie, Herr Schriftsteller, ein bisschen Respekt für Ihre Figuren!“ oder „Keine erklärenden Passagen, Freundchen. Oder hast du vergessen, dass du für Erwachsene schreibst?“ Jaja, wie witzig. Welcher Schriftsteller würde so einen Schmarren für ein Romanprojekt notieren? Ein paar Streichungen, und alles wäre in Ordnung. Aber offenbar wollte Aramburu diese Streichungen nicht haben.
Davon unberührt bleibt Julens Geschichte Ende der Sechzigerjahre, das schleichende Abgleiten in die Fänge der Eta. Nach einem politischen Mord verhängt das Franco-Regime den Ausnahmezustand über die Region, mit der Folge von willkürlichen Verhaftungen, Razzien, Prügeln in den Kellern der Polizeiwachen. Und doch wird das alles auf den vielen hundert Seiten von „Patria“, dem überragenden Roman von Fernando Aramburu, stärker, widersprüchlicher, ergreifender erzählt. „Langsame Jahre“ ist nicht mehr als das Vorspiel dazu, aber eines, das erkennen lässt, wie sich ein Schriftsteller auf den großen Wurf vorbereitet. So ist es, Freundchen, glaub mir, und so ist es gut.
RALPH HAMMERTHALER
Fernando Aramburu: Langsame Jahre. Roman. Aus dem Spanischen von Willi Zurbrüggen. Rowohlt Verlag, Hamburg 2019. 208 Seiten, 20 Euro.
Der Text wird immer wieder
unterbrochen von
Anmerkungen des Autors
Fernando Aramburu, geboren 1959 in San Sebastián.
Foto: afp / Bertrand Guay
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de