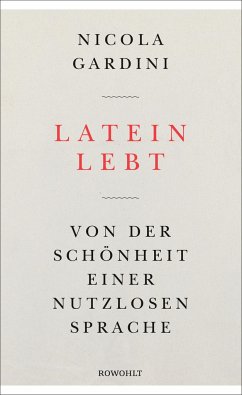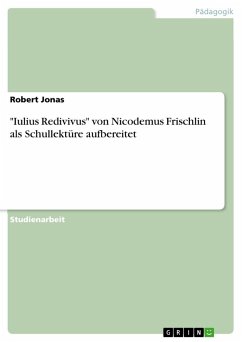Als Kind dachte Nicola Gardini, seine Mutter spräche perfekt Latein, weil er sie Ave Maria und Pater Noster beten hörte. Erst viel später hat sie ihm gebeichtet, dass sie sonst kein Wort Latein kann. Gardini beschreibt seinen Zugang zur lateinischen Literatur als persönliches Erweckungserlebnis, das ihm schon früh eine neue Welt erschlossen hat. Sein unterhaltsames Buch liefert kein verzweifeltes Plädoyer für das Schulfach Latein und die Bedeutung seiner Grammatik. Nicola Gardini zeigt vielmehr, dass wir nie aufgehört haben, Latein zu sprechen. dass wir unsere Gegenwart kulturell und literarisch nur verstehen können, wenn wir wissen, wo wir herkommen: Er geht Metaphern auf den Grund, er erklärt anhand eines Textes von Cato über das Pökeln das Futur oder analysiert ein Gedicht von Catull über den Tod eines Spatzen. Und so vermittelt er auf literarische Weise seine These: Latein ist nicht nützlich, Latein ist schön.
Bitte wählen Sie Ihr Anliegen aus.
Rechnungen
Retourenschein anfordern
Bestellstatus
Storno