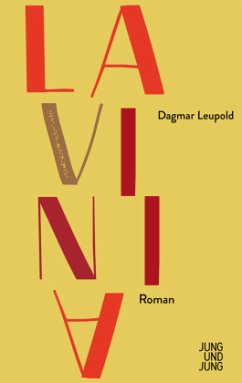Der Countdown beginnt im 25. Stock eines Hochhauses in New York: Worauf Lavinia von dort aus zurückblickt, ist ein Leben, vor dessen Abgründen ihr selbst schwindelt. Wie im Sturz durch ihre Geschichte und die Zeiten erzählt sie von ihrem Aufwachsen und Frauwerden, ihren Lieben und Verlusten, von Verheerungen und Missbrauch, von Unterwerfung und ihrem Willen, sich zu behaupten. Tiefer und tiefer führt sie den Leser im Taumel des Erinnerns und im Sprachrausch des Erzählens zurück in die deutsche Provinz nach dem Krieg, in das unschuldige wie ungeschützte Glücksempfinden einer Kindheit, die in Erfahrungen von Gewalt endet, zu den versuchten Abbrüchen und Aufbrüchen eines Lebens, das sich bei allem Wanken immer wieder unbeugsam zeigt.Lavinia ist eine Selbst- und Weltbetrachtung voller Hingabe und Wut, bitter und zärtlich, schonungslos und empathisch. Ein Lob der Liebe und ein Bekenntnis zu Widerständigkeit. Ein Buch darüber, wie sich beides in Literatur verbinden kann zu einem Rettungsversuch in schwindelnder Höhe.

Überdosis an Sprache, bittersüß: Dagmar Leupolds Roman "Lavinia" spricht von allem, was der Fall ist - und wird damit leider zum Fall für sich.
Von Rose-Maria Gropp
In diesem Buch sind die Kapitel sortiert nach allfälligen Ableitungen des Wortstamms "fallen". Es beginnt im 25. Stock eines Hochhauses in New York, von dem die Ich-Erzählerin in die Tiefe stürzt oder es jedenfalls vorgibt: "Wer ergründen will, muss fallen. Der Wind ist mein Freier", lauten die ersten Sätze von Dagmar Leupolds Roman "Lavinia", unter der Überschrift "Überfallen". Im Folgenden stürzt Lavinia durch die Fährnisse ihres Lebens, nicht ganz chronologisch, auch nicht alle Stockwerke entlang, nach Erlebnisqualitäten geordnet. Wobei die Männer am wenigsten als Befreier ihre Funktion haben, die meisten sind im Rückblick eher Katastrophen.
Schon der Name ist Programm. Lavinia war bei Vergil die Tochter von Latinus, dem König von Latium, der sie dem Aeneas zur Gattin gibt. In Heinrich von Veldekes "Eneasroman" wird sie Ende des zwölften Jahrhunderts zur großen Liebenden. Und die "Minne" wird zum Leitthema in Leupolds Roman, vor allem dort, wo sie fehlt, gern auch in mittelhochdeutschen Versen aufgerufen. Wie überhaupt viel Gelehrsamkeit im Spiel ist - Anglizismen, Zitate von der hohen bis zur populären Kultur, Anspielungen auf die Literatur aller Welt. "Cara Lavinia! Schalte mal runter! Nein ich halte fest an der Glut, ich verteidige sie bis aufs Blut, sie bewahrt mich vorm Chillen", heißt es früh. Der Rat wäre zu beherzigen gewesen, was die Minne, vulgo Sexualität, ebenso angeht wie die Bildungswut.
Außerdem strömt durch "Lavinia" - die Ich-Erzählerin wie den Roman - die deutsche Nachkriegsgeschichte, betrachtet durch ein Temperament, für das Sprache dem Sein vorgängig ist. Dagmar Leupold, Jahrgang 1955, unterzieht die Lebensgeschichte einer Frau ähnlichen Alters einer atemlosen Beschreibung - soll man lieber sagen: Dekonstruktion? Was automatisch den Verdacht auf autobiographische Rechenschaft, genauer Abrechnung weckt. Das allein müsste kein Fehler sein, weil die Banalität, im Wortsinn als Alltäglichkeit, noch immer ein dankbares Sujet sein kann. Aber Leupolds nachgerade diszipliniert assoziatives, vorsätzlich idiosynkratisches Schreiben folgt der Postmoderne des Erzählens. In prätentiös ältlichem Jargon hieße das "Sound" - Tonfall (passend zum Leitmotiv). Es kommt zu einer Überdosis verwehten Zeitgeists. Die so gewandte wie wortmächtige Autorin muss das wissentlich in Kauf genommen haben.
Es ist schade, dass in diesem Furor die gelungenen Passagen voller Intensität und Zuwendung untergehen. Wenn die Rede ist vom "Omale", Lavinias Großmutter, die, aus Ostpreußen vertrieben, nie Behaustheit fand im deutschen Südwesten, aber dem kleinen Mädchen einen warmen, weichen Schutzraum schenkt. Oder wenn es um das Ehepaar Stern geht, die als Juden von den Nationalsozialisten verfolgt waren und dann noch einmal Ende der Sechziger vor dem Antisemitismus in Polen fliehen mussten. Die Sterns schenken Lavinia, dem Kind, das bei den Eltern kaum heimisch ist, eine Zuflucht: "Nein, Sterne sind immer auf Augenhöhe. Wie sie heißen? Ich nenne sie bei ihrem Namen, sie heißen Walter und Hilde Stern. Kein walk of fame, keine galaktische Spur, nein, aus Asche ist der Pfad, dem ich, eingedenkend, folge." Doch selbst danach muss schon wieder, als traute die Autorin sich selbst nicht über den Sprachweg, eine Gedichtzeile her, die unerklärt bleibt (sie ist aus Paul Celans "Auge der Zeit").
Gegen Ende des Romans geht die virtuose Überblendungstechnik dann entschieden zu weit. Lavinia ist nach Syrakus auf Sizilien gereist, es ist der 10. September 2001. Vor einem Lokal wird sie von einem Belästiger von hinten gegen die Mauer gedrückt, Gesicht, Knie und Arme sind aufgeschürft, ehe sie vor ihm gerettet wird. Im Hotel schluckt sie Benzodiazepine, schläft stundenlang; beim Erwachen läuft der Fernseher: "Was sind das für Wolken, für Flammen, für Rauch, gehören die noch zum Traum? Was fliegt da? Was schreit da? 9/ 11/ 2001 steht unter den Bildern, in Fließschrift, also Schrift, die sich bewegt, dazwischen lauter Kreuzchen, ++++++, zählt da jemand Tote? Welche Toten? Wenn jemand dem anderen von hinten die Knie in die Kniekehlen rammt, dann knickt der ein, logisch. Das gilt auch für Türme."
Damit nicht genug: "Vorerst bleibe ich liegen, gefällt. In Endlosschleife die Penetration von Flugzeugen ins Betonfleisch, der Kollaps der Türme in Zeitlupe, dazwischen eingeblendet fassungslose Moderatoren, Weinende auf der Flucht, Trümmerregen. Es dauert, bis ich verstehe: Die Scherben sind echt. Das Blut ist echt. Die Asche ist echt. Am Anfang war das Wort, das Wort ist am Ende. Ich bin gerammt worden. Eine stolze Vertikale, fünfhundert Meter in den Himmel ragend, ist gerammt worden." Der inszenierte zeitliche Zusammenfall (passend zum Leitmotiv) geht an die Grenze der Obszönität. Nein, die fast 2800 Getöteten eines terroristischen Massenmords sind nicht zurückzubiegen in die Kniekehlen einer in Metaphern schwelgenden Frau. Das hätte Dagmar Leupold wissen müssen.
Lavinia ist die große Beleidigte, auf ganzer Linie. Leitwort neben dem Fallen und der Minne ist dolceamaro, bittersüß, wobei das Süße eher zu kurz kommt. "Lavinia lacrimosa" heißt es einmal. Die Abrechnung mit den Männern - "Wir haben gemeinsame Sache gemacht. Ich habe es euch leicht gemacht. Auch die schreibe ich hier ab - die es euch leicht gemacht hat" - kommt unvermeidlich am Ende, unten angekommen, erster Stock, als "Wutanfall": "Männer von Welt! Männer fürs Grobe! Feingeister! Vorgesetzte, Untersetzte, Langatmige und Kurzweilige! Ich schreibe euch auf." Ist das jetzt eine Drohung? Ist das ein leiser Anflug von Selbstironie? Oder eine lustig gemeinte Bankrotterklärung, wenn da gedruckt steht: "Ab mit euch zwischen eckige Klammern, [[[[[[[......]]]]]]], ab hier Verbannung." Eine Lösung auf Dauer ist das jedenfalls nicht.
Dagmar Leupold: "Lavinia". Roman.
Verlag Jung und Jung, Salzburg 2019. 208 S., geb., 21,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main