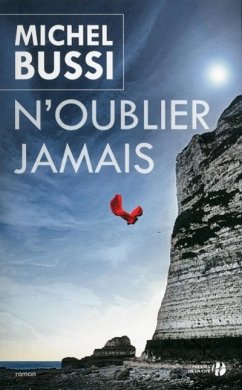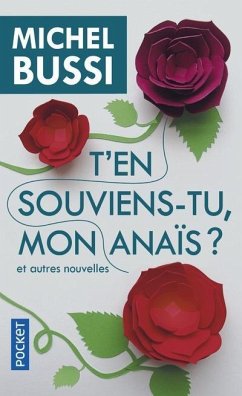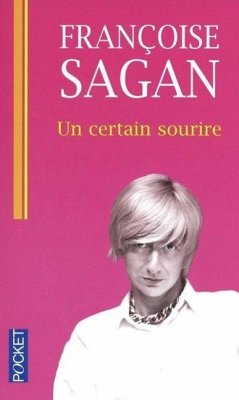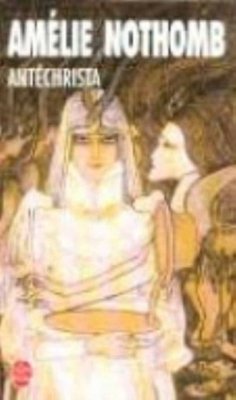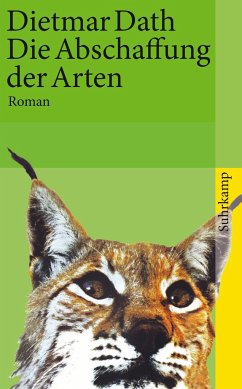Le testament francais
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
10,99 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
5 °P sammeln!
Aljoscha verbringt den Sommer bei seiner Großmutter Charlotte in der unendlichen Weite Sibiriens. Dort stößt er auf einen Koffer, der sie durch "all die Revolutionen, Kriege, gescheiterten Utopien und erfolgreichen Schreckensherrschaften" des Jahrhunderts begleitet hat. Er ist gefüllt mit Erinnerungsstücken aus Paris, wo sie einst ihre Kindheit verbrachte. Aljoscha kann nicht genug hören aus jener Zeit um die Jahrhundertwende. Auf seine französische Großmutter ist Aljoscha zugleich stolz und zornig, denn ihretwegen wird er von seinen Kameraden verspottet, weil er anders ist. Mal fühlt...
Aljoscha verbringt den Sommer bei seiner Großmutter Charlotte in der unendlichen Weite Sibiriens. Dort stößt er auf einen Koffer, der sie durch "all die Revolutionen, Kriege, gescheiterten Utopien und erfolgreichen Schreckensherrschaften" des Jahrhunderts begleitet hat. Er ist gefüllt mit Erinnerungsstücken aus Paris, wo sie einst ihre Kindheit verbrachte. Aljoscha kann nicht genug hören aus jener Zeit um die Jahrhundertwende. Auf seine französische Großmutter ist Aljoscha zugleich stolz und zornig, denn ihretwegen wird er von seinen Kameraden verspottet, weil er anders ist. Mal fühlt er sich als Russe, dann wieder als Franzose, und erst als er schließlich selbst nach Paris kommt, findet er Frieden.