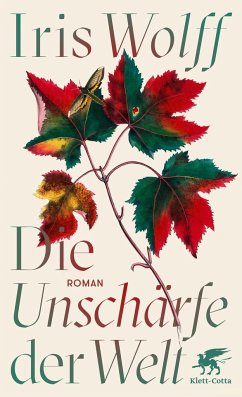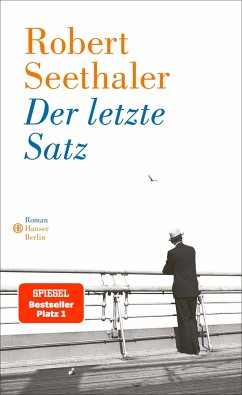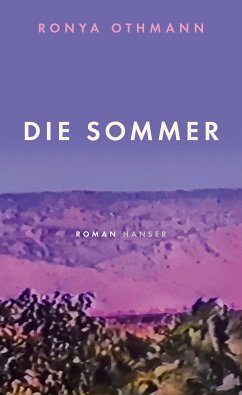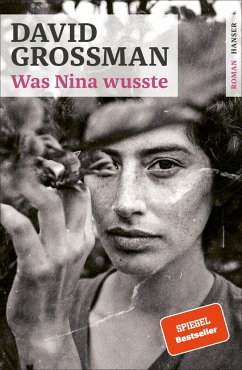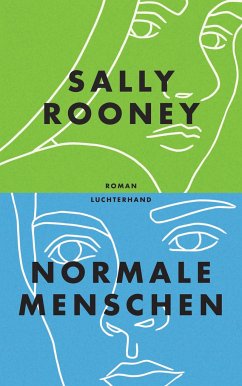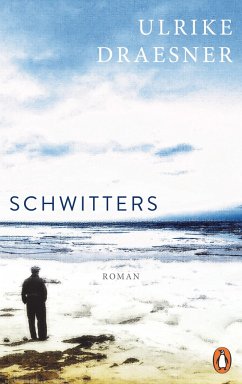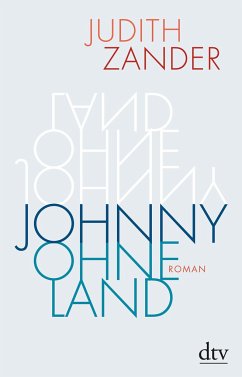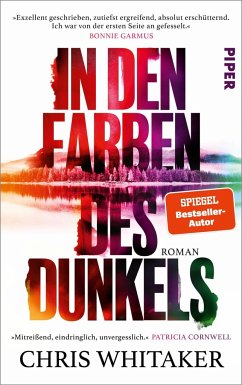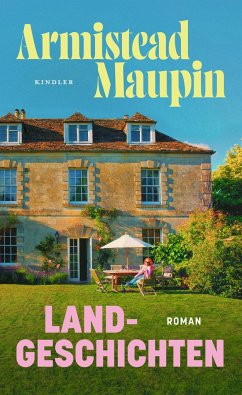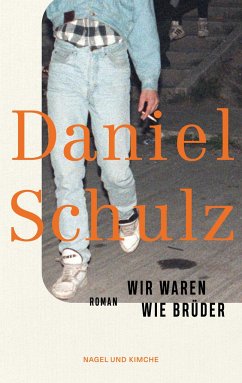Rolf Lappert
Gebundenes Buch
Leben ist ein unregelmäßiges Verb

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





Rolf Lapperts großer Roman über Freundschaft, Verlust und den Trost der Erinnerung.Eine Aussteiger-Kommune auf dem Land, 1980: Die Behörden entdecken vier Kinder, die versteckt vor der Welt aufgewachsen sind. Ihre Schicksale werden auf Schlagzeilen reduziert, doch Frida, Ringo, Leander und Linus sind vor allem Menschen mit eigenen Geschichten. Aus der Isolation in die Wirklichkeit geworfen, blicken sie staunend um sich. Und leben die unterschiedlichsten Leben an zahllosen Orten: In Pflegefamilien und Internaten, auf Inseln und Bergen, als Hassende und Liebende. Wie finden sich Verlorene in ...
Rolf Lapperts großer Roman über Freundschaft, Verlust und den Trost der Erinnerung.Eine Aussteiger-Kommune auf dem Land, 1980: Die Behörden entdecken vier Kinder, die versteckt vor der Welt aufgewachsen sind. Ihre Schicksale werden auf Schlagzeilen reduziert, doch Frida, Ringo, Leander und Linus sind vor allem Menschen mit eigenen Geschichten. Aus der Isolation in die Wirklichkeit geworfen, blicken sie staunend um sich. Und leben die unterschiedlichsten Leben an zahllosen Orten: In Pflegefamilien und Internaten, auf Inseln und Bergen, als Hassende und Liebende. Wie finden sich Verlorene in der Welt zurecht? In seinem ganz eigenen zärtlich-lakonischen Ton erzählt Rolf Lappert in diesem großen Roman wie man sich von seiner Kindheit entfernt, ohne sie jemals hinter sich zu lassen.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Rolf Lappert wurde 1958 in Zürich geboren und lebt in der Schweiz. Er absolvierte eine Ausbildung zum Grafiker, war später Mitbegründer eines Jazz-Clubs und arbeitete zwischen 1996 und 2004 als Drehbuchautor. Bei Hanser erschienen 2008 der mit dem Schweizer Buchpreis ausgezeichnete Roman Nach Hause schwimmen, 2010 der Roman Auf den Inseln des letzten Lichts, 2012 der Jugendroman Pampa Blues, 2015 der Roman über den Winter sowie 2020 sein neuer Roman Leben ist ein unregelmäßiges Verb.
Produktdetails
- Verlag: Hanser
- Artikelnr. des Verlages: 505/26756
- 2. Aufl.
- Seitenzahl: 992
- Erscheinungstermin: 17. August 2020
- Deutsch
- Abmessung: 218mm x 152mm x 48mm
- Gewicht: 978g
- ISBN-13: 9783446267565
- ISBN-10: 3446267565
- Artikelnr.: 59016404
Herstellerkennzeichnung
Carl Hanser Verlag
Kolbergerstraße 22
81679 München
info@hanser.de
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rezensent Martin Halter hat großen Respekt vor Rolf Lapperts epischer Erzählweise. Allein die vielen anachronistischen Wörter und Metaphern im Text und der langsam mäandernde Weg von vier Ex-Hippiekommunarden ins "echte" Leben, den Lappert à la John Irving beschreibt, ermüden den Rezensenten letztlich doch sehr. Wie liebevoll, detailgenau und vielseitig, mit Formaten wie Tagebuch, Minidrama, Interviews, der Autor seinen Figuren folgt, findet Halter aber dennoch besonders.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Lappert greift mit großem epischen Schwung hinein ins volle Menschenleben. Nicht umsonst vergleicht man ihn gern mit John Irving." Martin Halter, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 02.02.21 "Das alles ist sprachlich wie formal gekonnt erzählt, die vier Biografien werden verfolgt und in Rückblenden das Kommunenleben dargestellt ... - so wie das heute die wahren Könner ihres Faches eben tun." Peer Teuwsen, Neue Zürcher Zeitung, 30.08.20 "Lappert ist ein Epiker, der seine Geschöpfe mit zärtlicher Sorge begleitet. Ein Epiker ganz großen Formats." Martin Ebel, Süddeutsche Zeitung, 26.08.20
1980. Leander, Frida, Ringo und Linus, vier Zwölfjährige, aufgewachsen in einer niedersächsischen Land-WG, in der die Erwachsenen sich von den Reglementierungen der Gesellschaft befreien wollen und abgeschottet als Selbstversorger leben. Aber sie ignorieren auch geltende Gesetze wie …
Mehr
1980. Leander, Frida, Ringo und Linus, vier Zwölfjährige, aufgewachsen in einer niedersächsischen Land-WG, in der die Erwachsenen sich von den Reglementierungen der Gesellschaft befreien wollen und abgeschottet als Selbstversorger leben. Aber sie ignorieren auch geltende Gesetze wie die Schulpflicht, was letzten Endes dazu führt, dass die Kommune von den Behörden zerschlagen wird und man die Kinder aus ihrer gewohnten Umgebung reißt.
Sie werden getrennt, bei Verwandten oder Pflegefamilien untergebracht, die sich mal mehr, mal weniger gut um sie kümmern und ihnen helfen sollen, sich in einer Welt zurechtzufinden, die ihnen komplett fremd ist. Zwar haben sie eine Ahnung von dem Leben dort draußen, aber diese speist sich im Wesentlichen aus dem, was die Erwachsenen ihnen eingetrichtert haben. Aber glücklicherweise gibt es da auch noch die Erinnerungen an die Klassiker der Weltliteratur, aus denen ihnen Konrad abends vorgelesen hat und die ihnen helfen, ihre neue Lebenssituation einzuordnen.
Alternierend verfolgen wir in den nachfolgenden vierzig Jahren ihre Wege, ihre Versuche der Anpassung und der Rebellion und schlussendlich des Scheiterns.
Der Roman lässt mich zwiespältig zurück. Auf der einen Seite ist da diese unglaublich beeindruckende Sprache, einfallsreich und fantasievoll, die jedem der vier Leben einen eigenen Klang verleiht. Auf der anderen Seite die Komplexität der Lebensgeschichten, und damit sind wir auch schon bei dem Punkt, an dem meine Kritik ansetzt. Ab knapp der Hälfte des Romans gehen die Pferde mit dem Autor durch, er kommt vom Hölzchen auf‘s Stöckchen. Eine dramatische Situation jagt die nächste, Klischeefallen nicht vermieden, eine Unmenge von Figuren ohne besondere Funktion für den Fortgang der jeweiligen Geschichte eingeführt. Komplexität schön und gut, aber man muss es ja nicht gleich übertreiben. So bleiben am Ende fast 1000 Seiten, prall gefüllt mit allerlei Überflüssigem, die man meiner Meinung nach durchaus ohne Qualitätsverlust hätte einkürzen können.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
In diesem Monumentalwerk - auf fast tausend Seiten - verfolgt Rolf Lappert die Leben von vier Menschen: Leander, Frieda, Ringo und Anton - die ein höchst ungewöhnliches Schicksal teilten: bis zu ihrem zwölften Lebensjahr wuchsen sie in einer auf einem norddeutschen Bauernhof …
Mehr
In diesem Monumentalwerk - auf fast tausend Seiten - verfolgt Rolf Lappert die Leben von vier Menschen: Leander, Frieda, Ringo und Anton - die ein höchst ungewöhnliches Schicksal teilten: bis zu ihrem zwölften Lebensjahr wuchsen sie in einer auf einem norddeutschen Bauernhof geschaffenen völlig eigenen Welt auf, abgeschottet von der Welt, von der bundesdeutschen Entwicklung, von der Schule - einfach von allem. Winnipeg, so nannten die Kinder den Hof und damit ihre Welt.
Es ist der Beginn der 1980 Jahre, als sie befreit werden - so sieht es die Welt. Die Vier empfinden sich als aus dem Nest geworfen, zumal sie nun von einander getrennt werden, worauf einer von ihrnen - Anton - nach einiger Zeit mit dem Freitod reagiert.
Im Mittelpunkt stehen die Schicksale von Leander und Frieda, die es wohl objektiv gesehen am besten getroffen haben, weil sie bei Verwandten - Leander bei seiner Tante Meret, Frieda bei ihrer Großmutter und deren Mann untergebracht werden. Ringos Erlebisse werden zu einem großen Teil in einem Interview mit einer Journalistin dargelegt und Anton - nun, das ist etwas ganz anderes, eigenes.
Auf gewisse, vollkommen unterschiedliche Art kommt keines der Kinder - nicht nur Anton - nicht im realen Leben an.
Rolf Lappert schreibt eindringlich, dabei sehr detailgenau, führt zahlreiche Personen ein, von denen die meisten die Hauptfiguren nur ein Stück ihres Weges begleiten. Ich hatte teilweise mit den Namen zu kämpfen und hätte mich hier sehr über ein Glossar gefreut, dass sich sehr gerne auch auf Ortschaften und Lokalitäten hätte erstrecken dürfen.
Ja, es ist ein faszinierender, gekonnter und eleganter Stil, in dem der Roman verfasst ist - besonders beeindruckt hat mich, dass die Sprache bei jedem der Protagonisten wechselte - teilweise sehr klar, dann auch wieder nur in Ansätzen.
Wem sage ich es, Rolf Lappert kann schreiben und er hat hier eine tolle Idee realisiert, gewissermaßen ein Jahrhundertwerk geschaffen, bei dem aber so einiges des Guten zuviel war. Einige der Nebenschauplätze und Nebenfiguren sind für die Handlung und Entwicklung des Romans so irrelevant, dass sie aus meiner Sicht hätten weggelassen werden können.
Eigentlich bin ich eine schnelle Leserin und kann mich auf Werke, die mich gefangen nehmen, auch gut konzentrieren. Hier jedoch brauchte ich viele, viele Pausen und habe insgesamt über einen Monat am Buch "genagt".
Aber es hat sich gelohnt - ein gleich mehrfacher Coming-of-Age-Roman der besonderen Art, den ich nicht so schnell vergessen werde. Wenn überhaupt.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Eine Kommune mitten in der Abgeschiedenheit Norddeutschlands. Vier Kinder wachsen ohne Kontakt zur Außenwelt auf. Leander, Linus, Frida und Ringo werden regelrecht abgeschirmt. Der Hof, auf dem sie groß werden und auf dem sie täglich die Felder und Wiesen bewirtschaften und die …
Mehr
Eine Kommune mitten in der Abgeschiedenheit Norddeutschlands. Vier Kinder wachsen ohne Kontakt zur Außenwelt auf. Leander, Linus, Frida und Ringo werden regelrecht abgeschirmt. Der Hof, auf dem sie groß werden und auf dem sie täglich die Felder und Wiesen bewirtschaften und die Tiere versorgen, ist ihr Zuhause. Eines Tages jedoch finden sie etwas von dieser anderen Welt und auch sie werden gefunden. Ab dann ist nichts mehr wie es war. Rolf Lappert zeichnet in seinem Roman die Leben dieser vier Kinder bis ins Erwachsenenalter. Wie kommen sie in dieser für sie komplett neuen Welt klar? Wer überlebt oder wer trägt Schaden davon?
Ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll. Der Anfang und das Ende haben eine gewaltige sprachliche Eindringlichkeit und offenbaren jede erdenkliche Gefühlsebene. Besonders im ersten Drittel gab es vor allem zu Leander's Schulzeit noch einige Schmunzler und vereinzelt Lacher. Später verlief das Leben der Kinder leider nicht mehr wie erhofft. Eine Tür öffnete sich, kurz darauf schloss sie sich wieder. Jeder Neubeginn bedeutete kurz darauf wieder Abschied nehmen. Eine schlechte Nachricht nach der anderen folgte. Vor allem Ringo's Erzählungen erzeugten Momente, die mir Gänsehaut bereitet haben.
"Nichts, denke ich. Aus mir ist ein Nichts geworden, ein Niemand. Ich bin die alten Männer, die ich gerettet habe, diese zukunftslosen Gestalten, abgelaufenen Modelle. Ich bin Ringo, den es nicht mehr gibt, bin Frida, die fortgegangen ist, ausgewandert in ein erfundenes Land, um mir in Tagträumen zu erscheinen und im Dunkeln aufzulauern."
Selten liest man so wortgewandte Zeilen - fließend fügt sich alles zusammen. Abwechslung schafft Rolf Lappert durch die verschiedenen Erzählperspektiven und Tagebucheinträge. Einziger Minuspunkt ist der langwierige Mittelteil und die hinzukommenden Nebenfiguren. Viele Nebenfiguren sind einfach nur Einschübe und nehmen keinen Einfluss auf den Ausgang der Geschichte. Teilweise musste ich mich erst wieder sammeln und die Personen sortieren, wer zu wem gehört. Hier nahmen die detaillierten Schilderungen der einzelnen Figuren Formen ähnlich wie bei Irving an. Auf knapp 1000 Seiten gibt er Einblicke in die Gefühlswelt und die Lebenswege der ehemaligen Kommunenkinder. Keine leichte Kost. Oft reiht sich Drama an Drama und scheint kein Ende zu nehmen. Wie denn auch, wenn den Kindern das vertraute Zuhause weggenommen wurde?
"Wir sind niemand, wenn wir nicht zusammen sind. Zu viert sind wir eine Geschichte mit einem Anfang und einem im Dachbodendunkel geduldig erwarteten Ende. Einzeln sind wir Wörter, unbegreifliche Sätze. Was uns ausmacht, ist das Zurücklassen, das neu Anfangen, das Zurechtfinden und Verlorengehen. Wir müssen lernen, ich zu sein, und scheitern."
Ein beeindruckendes Werk, das ich sicher mehrmals in die Hand nehmen werde, um die Erzählungen erneut auf mich wirken zu lassen.
Durchhalten lohnt sich hier, auch wenn die Seitenzahl schon sehr erschreckend ist. Das Ende war überraschend für mich und ließ mich mit gefühlt tausend Fragen zurück. Einerseits habe ich mir innerlich die Haare gerauft, andererseits hätte ich den Schluss selbst nicht besser hinbekommen und letztendlich ist er einfach perfekt umgesetzt.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für