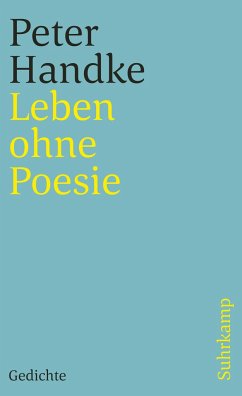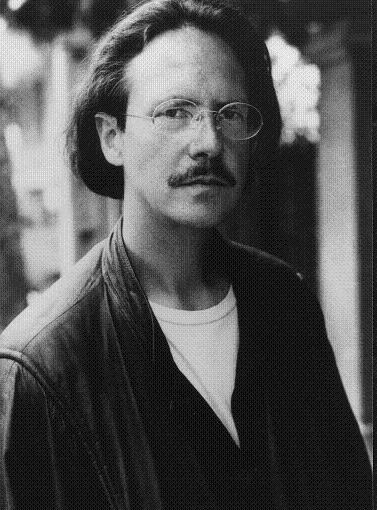1969 erschien, wie es damals hieß, ein »Reader« von Peter Handke, der den Untertitel trug: Prosa Gedichte Theaterstücke Hörspiele Aufsätze. Die dort abgedruckten Gedichte waren dem im selben Jahr publizierten Band Die Innenwelt der Außenwelt der Innenwelt entnommen, in dem der Autor 42 für Lyrik bisher nicht verwendete Textformen entdeckte: etwa Die Aufstellung des 1. FC Nürnberg vom 27.1.1968, den Vorspann zum Film Bonnie und Clyde usw. Und obwohl Peter Handke in den darauffolgenden Jahren als Prosa- und Theaterautor in den Vordergrund trat, wendete er sich nicht von der Ausdrucksform Gedicht ab. Dies belegen etwa die Langgedichte Leben ohne Poesie oder Blaues Gedicht in dem Band Als das Wünschen noch geholfen hat (1974), das Gedicht an die Dauer (aus dem Jahre 1986) sowie die Haikus in den Notizbüchern, etwa den 2005 veröffentlichten Gestern unterwegs.

Ihr sollt ihn nicht durch Widerspruch verwirren; sobald er spricht, beginnt er schon zu irren: Peter Handke kehrt in seinen Gedichten zurück ins Haus der Sprache.
Er sei kein Lyriker. Mit dieser Bemerkung hat Peter Handke eine Sammlung seiner Gedichte zunächst abgelehnt, dann aber dem Drängen seiner Verlegerin nachgegeben. Nun also gibt es sie, die gesammelten Gedichte, und der Dichter hat an Auswahl und Gliederung selbst mitgewirkt. "Leben ohne Poesie" umfasst fast alles, was Handke seit seinem vielbeachteten Bändchen "Die Innenwelt der Außenwelt der Innenwelt" an lyrischen Texten publiziert hat; darunter den Band "Gedicht an die Dauer" und weitere Lang- und Kurzgedichte, die in diversen Prosabänden und in seinen fünf Notizbüchern erschienen sind. Ist Handke also doch ein Lyriker?
Als Handke in den Sechzigern mit lyrikhaften Texten anfing, waren das grammatikalisch-linguistische Exerzitien, mal streng, mal witzig; es waren Satzspiele, Wörterspiele, Begriffsspiele. Sie waren einfallsreich und wirkten avantgardistisch. Sie führten modellhaft sprachliche Übereinkünfte und Klischees vor, um sie zur Disposition zu stellen. Der junge Österreicher mochte als Erbe von Karl Kraus erscheinen. Er wollte aber keiner von den Epigonen sein, die im alten Haus der Sprache wohnen. Er wollte das alte Haus demontieren. Vielleicht suchte er auch nach einem neuen Haus.
Der früheste Text in "Die Innenwelt der Außenwelt der Innenwelt" stammt von 1965. "Das Wort Zeit" beginnt: "Die Zeit ist ein Hauptwort. Das Hauptwort bildet keine Zeit. Da die Zeit ein Hauptwort ist, bildet die Zeit keine Zeit." Man konnte derlei linguistische Beweisführungen durchaus als zeitfeindlich oder zeitkritisch verstehen; und damals, im Gefolge revolutionärer Stimmungen, hat man Handkes Sprachkritik oft kurzerhand als Gesellschaftskritik genommen. Aber Handke hatte nicht bloß sprachliche, sondern auch Dingklischees im Auge, die Erfahrung verhindern.
Er fand sich "Am Rande der Wörter" und wollte - anders als die damaligen Experimentellen - nicht in die Wörter zurück, sondern über sie hinaus. Er suchte und fand "Die neuen Erfahrungen". Sie erscheinen zunächst als gegliederte Rituale, als wollten sie lediglich die Zwänge gesellschaftlichen Verhaltens kenntlich machen; aber dann schlug doch und wie unvermittelt ein existentielles Moment durch: "1948 / an der bayrisch-österreichischen Grenze / im Ort Bayrisch-Gmain ( ,in welchem Haus mit welcher Nummer?') sah ich / auf einem Bettgestell / unter einem Leintuch / hinter Blumen / zum ersten Mal / einen Menschen der tot war." Modellsituation oder schon autobiographisches Bekenntnis? Dieser Text von den neuen Erfahrungen steht nicht ohne Grund zu Anfang des Innenwelt-Außenwelt-Bändchens, am Anfang auch des lyrischen OEuvres. Er markiert eine Weggabelung. "Die Literatur ist romantisch" war der Titel einer kleinen Broschüre, einer Absage an das damals modische Engagement. Der geheimnisvolle Weg - so schien es - würde fortan nach innen gehen.
In den siebziger Jahren schrieb Handke drei lange Gedichte: 1972 "Leben ohne Poesie", 1973 "Blaues Gedicht" und 1974 "Die Sinnlosigkeit und das Glück". Sie stehen nun, in umgekehrter Reihenfolge, am Schluss des Sammelbandes, quasi als Summe des Handkeschen Poetisierungsprogramms von Welt und Leben.
Ich gestehe mein besonderes Faible für das "Blaue Gedicht", für die wunderbare Übergänglichkeit seiner Motive. Aus einem nächtlichen Überfall von Sexualität wechselt es in die Erfahrung von Bedrohung und Depersonalisierung: "Das Licht / wenn ich blinzelte / hatte eine Farbe aus der Zeit / als ich noch an die Hölle glaubte / und das pfeifende Monster vor dem Fenster / schüttelte lautlos die Handgelenke / als ob es nun Ernst machen wollte." Das Gedicht mündet in das Erlebnis eines anderen, südlichen Landes und in die neue Erfahrung von Freundschaft, Liebe, Verbundenheit: ",Schönheit ist eine Art von Information' dachte ich / warm von dir / und von der Erinnerung." Handke war auf dem Weg seiner langsamen Heimkehr.
Eines der Hauptdokumente dafür, ja, ein klassisches Zeugnis ist sein "Gedicht an die Dauer". Es hat wunderbar dichte Passagen von Welt- und Erfahrungsgehalt; so die Szene vom Baden mit Freunden im griechischen, weinfarbenen Meer. Doch es will nicht verleugnen, dass es ein Lehrgedicht ist, ein Poem, das ohne Rhetorik nicht auskommt: "Ich habe es, wieder einmal, erfahren: / Die Ekstase ist immer zuviel, / die Dauer dagegen das Richtige." Dieser Wahrspruch muss Handke denn doch zu apodiktisch erschienen sein. Er relativiert etwas später: "Auf die Dauer ist kein Verlaß." Aber doch auf Handkes artistisches Geschick, sagen wir ruhig, auf seinen Takt.
Die eigentlichen Überraschungen des schönen und schön gemachten Bandes finden sich im Mittelteil "Das Ende des Flanierens". Was Walter Benjamin vom Flaneur sagt, dass er sein Asyl in der Menge sucht, lässt sich auf den Paris- und Landschaftsflaneur Handke beziehen. Er ist, wie Baudelaire, ein Mann der Schwelle. Hier sammelt und prüft und verlässt er seine Augenblicke.
Manchmal sind es poetische Einfälle, die ein Stück weit ausgeführt werden, ohne den Status des Gedichts zu beanspruchen. Manches ist bloß Notiz, aber keines ganz belanglos. "Am Nachmittag fielen ein paar Blätter / von den Akazien / Und am Abend schwankte die Lampe / im leeren Eßzimmer." Hat man das gelesen, empfindet man den Titel "Tageslauf in einem Sommergarten" fast als entbehrlich. Anderes ist in seiner Knappheit fast makellos. So ein Dreizeiler in den regelgerechten siebzehn Silben des Haiku: "In der Stille: am Platz / In der Stille: die Ankunft / Schatzhaus der Stille." Nur ein Beckmesser wünschte sich die Doppelpunkte getilgt. Er verkennte, dass auch im meditativen Moment ein Element der Lehre enthalten ist.
Handkes langsame Heimkehr hat ihn in das alte Schatzhaus der Sprache zurückgeführt. Sein langer Rückzug aus der Avantgarde und ihrer hybriden Fortschrittsdoktrin hat nichts mit Epigonie zu schaffen. Die Frage, ob er ein Lyriker ist, hat er damit auf ihre immanente Spitzfindigkeit zurückgeführt. Außerdem hat er sie selbst auf die schönste Weise beantwortet, im Gedicht: "Der Lyriker sitzt schön im Haus / der lyrische Epiker geht über die Hügel / der epische Epiker wird auf die Schiffe verschlagen." Also was tut Handke? Er lässt seinen Lesern die Wahl, mit welcher der drei Figuren sie ihn identifizieren wollen. Ich würde mich für den lyrischen Epiker entscheiden, der über die Hügel geht. Aber wahrscheinlich ist das nur ein Drittel der Wahrheit.
HARALD HARTUNG
Peter Handke: "Leben ohne Poesie". Gedichte. Herausgegeben von Ulla Berkéwicz. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2007. 240 S. br. 14,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
"Er sei kein Lyriker". Mit dieser Selbsteinschätzung Peter Handkes beginnt Harald Hartungs Rezension dieses Bandes mit dann eben doch Gedichten des Autors. Versammelt ist fast das sämtliche von Handke seit dem Band "Die Innenwelt der Außenwelt der Innenwelt" verfasste lyrische Werk. Als "avantgardistischer" Sprachspieler hat der Dichter, so Hartung, begonnen, dann aber kam es zur Wende und dem Wunsch der Darstellung "neuer Erfahrungen". Von den drei Langgedichten der siebziger Jahre präferiert der Rezensent das mit dem Titel "Blaues Gedicht", sehr angetan ist er aber auch vom Mittelteil "Das Ende des Flanierens", der Notizen, Bruchstücke oder gar ein regelgerechtes Haiku präsentiert. Dem Urteil des Dichters, dass er kein Lyriker sei, will sich Hartung nach Lektüre des Bandes nicht mehr anschließen. Mindestens, findet er, sei Handke ein "lyrischer Epiker".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH