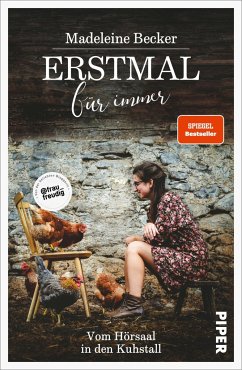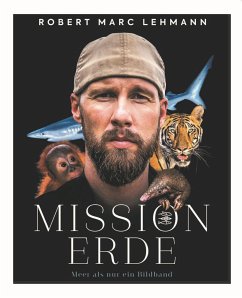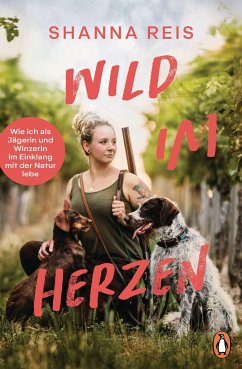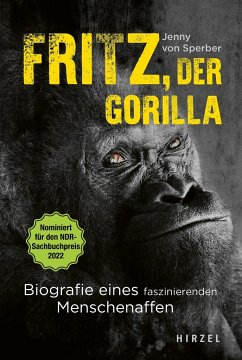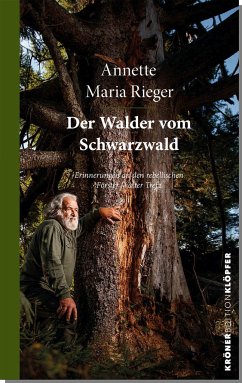Nicht lieferbar

Leben unter Rehen
Sieben Jahre in der Wildnis Der Bestseller aus Frankreich: Wie ein Mann bei den Tieren des Waldes überlebt
Übersetzung: Neeb, Barbara; Schmidt, Katharina
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:
Der mit den Rehen lebtSchon als Teenager sind ihm die Tiere näher als die Menschen. Am liebsten streift Geoffroy Delorme in den Wäldern hinter seinem Elternhaus in der Normandie umher. Als er eines Tages auf einen neugierigen Rehbock trifft, der schnell Vertrauen zu ihm fasst, schließt er sich ihm an.In den folgenden Jahren kehrt Delorme immer seltener und schließlich gar nicht mehr in die Zivilisation zurück. Ohne Decke und Zelt lebt er bei den Rehen. Er orientiert sich an ihrem Schlafrhythmus und lernt, wie man ein Revier anlegt und nährstoffreiche Pflanzen findet. Wie man sich nachts ...
Der mit den Rehen lebt
Schon als Teenager sind ihm die Tiere näher als die Menschen. Am liebsten streift Geoffroy Delorme in den Wäldern hinter seinem Elternhaus in der Normandie umher. Als er eines Tages auf einen neugierigen Rehbock trifft, der schnell Vertrauen zu ihm fasst, schließt er sich ihm an.
In den folgenden Jahren kehrt Delorme immer seltener und schließlich gar nicht mehr in die Zivilisation zurück. Ohne Decke und Zelt lebt er bei den Rehen. Er orientiert sich an ihrem Schlafrhythmus und lernt, wie man ein Revier anlegt und nährstoffreiche Pflanzen findet. Wie man sich nachts warm hält und im Wechsel der Jahreszeiten überlebt. Dabei wird er Zeuge, wie Kitze geboren werden, aber auch, wie Jäger die Tiere abrupt aus dem Leben reißen.
»Atemberaubend, bescheiden und gefühlvoll« Arte
In dem tief bewegenden Bestseller aus Frankreich erzählt der junge Autor zärtlich und voller Demut davon, wie er sich auf der Suche nach einem erfüllten Leben von der menschlichen Gesellschaft abwendet. Von der Kompromisslosigkeit und zugleich heilenden Kraft der Natur. Und von der faszinierenden, uns oftmals verborgenen Welt der Waldbewohner.
Die einzigartige Geschichte eines jungen Mannes auf der Suche nach einem erfüllten Leben
Mit seltenen Einblicken in das Leben der Rehe und anderer WaldbewohnerÜber den Wald als Kraft- und Rückzugsort
Schon als Teenager sind ihm die Tiere näher als die Menschen. Am liebsten streift Geoffroy Delorme in den Wäldern hinter seinem Elternhaus in der Normandie umher. Als er eines Tages auf einen neugierigen Rehbock trifft, der schnell Vertrauen zu ihm fasst, schließt er sich ihm an.
In den folgenden Jahren kehrt Delorme immer seltener und schließlich gar nicht mehr in die Zivilisation zurück. Ohne Decke und Zelt lebt er bei den Rehen. Er orientiert sich an ihrem Schlafrhythmus und lernt, wie man ein Revier anlegt und nährstoffreiche Pflanzen findet. Wie man sich nachts warm hält und im Wechsel der Jahreszeiten überlebt. Dabei wird er Zeuge, wie Kitze geboren werden, aber auch, wie Jäger die Tiere abrupt aus dem Leben reißen.
»Atemberaubend, bescheiden und gefühlvoll« Arte
In dem tief bewegenden Bestseller aus Frankreich erzählt der junge Autor zärtlich und voller Demut davon, wie er sich auf der Suche nach einem erfüllten Leben von der menschlichen Gesellschaft abwendet. Von der Kompromisslosigkeit und zugleich heilenden Kraft der Natur. Und von der faszinierenden, uns oftmals verborgenen Welt der Waldbewohner.
Die einzigartige Geschichte eines jungen Mannes auf der Suche nach einem erfüllten Leben
Mit seltenen Einblicken in das Leben der Rehe und anderer WaldbewohnerÜber den Wald als Kraft- und Rückzugsort