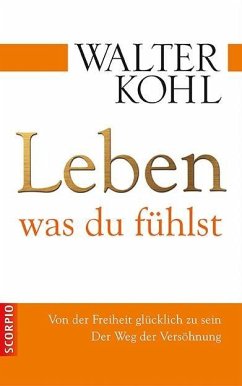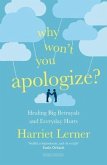Glücklich sein trotz schwieriger Lebensumstände. Endlich leben, statt gelebt zu werden. Ist das möglich? Walter Kohl zeigt Wege auf, wie wir uns mit der Kraft der Versöhnung von langjährigen Belastungen befreien und alten Schmerz in neue Energie umwandeln können. Er ist überzeugt: Wenn wir uns unseren schmerzlichen Gefühlen offen und ehrlich stellen, können wir belastende Erlebnisse innerlich heilen und neue Lebensabschnitte friedlich, eigenverantwortlich und in Freude gestalten. Kampf oder Flucht sind typische Reaktionsmuster, um mit belastenden persönlichen Erlebnissen umzugehen. Allerdings halten uns beide Strategien in der Regel in unserem Schmerz gefangen. Doch es gibt noch einen weiteren Ansatz: den Weg der Versöhnung. Walter Kohl war durch sein Leben als "Sohn vom Kohl" und den Freitod seiner Mutter selbst schweren emotionalen Erschütterungen ausgesetzt. Er weiß aus eigener Erfahrung: Versöhnung ist eine starke Quelle neuer innerer Kraft, die einen Menschen zu sich selbst führt und neues Denken, Fühlen und Handeln ermöglicht. Dazu müssen wir aber die Versöhnung in uns entdecken, zulassen und aktivieren. Im Praxisbuch zu seinem Bestseller Leben oder gelebt werden beschreibt er, wie wir lernen, uns unseren Gefühlen zu stellen und die schmerzhaften Episoden der Vergangenheit in neue Kraft zu verwandeln. Wir können aktiv und bewusst inneren Frieden mit unseren alten Schmerzen schließen und damit das Steuer unseres Lebens wieder selbst in die Hand nehmen.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Das "therapeutische Bastelbuch" des ewigen Kohl-Sohnes Walter genießt Marie Schmidt mit Vorsicht. Denn: Was dem Sohnemann des laut Rezensentin im Buch stets übermächtig präsenten Schattenmannes zur Selbsttherapie gereichen mag, könnte auf andere wie schlichte und schlicht formulierte Küchenpsychologie wirken. Wer wie der Autor den Ausweg aus dem finsteren BRD-Patriarchat noch nicht gefunden hat, dem scheint Schmidt das Buch allerdings ans Herz zu legen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH