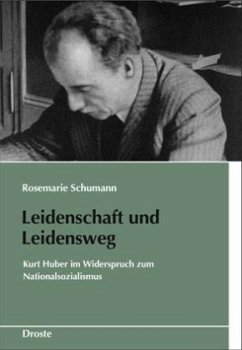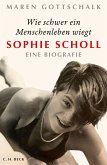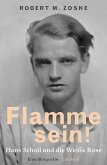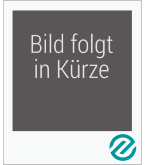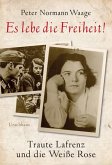Der Name Professor Dr. Kurt Huber wird gewöhnlich im Zusammenhang mit der studentischen Widerstandsgruppe Weiße Rose genannt. Er wurde 1943 von den Nationalsozialisten enthauptet. Dieses Buch handelt von Hubers Leistungen auf den Gebieten der Philosophie, der Musikwissenschaft, der Psychologie und der Volksliedforschung. Dazu wurden neue Quellen erschlossen. Ziel ist es, den Wissenschaftler Kurt Huber deutlicher in das Gedächtnis der Öffentlichkeit zu rufen sowie die Akteure im Kreis der Weißen Rose historiographisch ausgewogen und gerechter einzuordnen.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Professor Kurt Huber und die "Weiße Rose"
Mit dem Bau eines phonetischen "Universalanalysators" wollte er Karriere als Musikologe machen - in die Geschichte eingegangen ist er durch seinen Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime, den er mit dem Leben bezahlte: Kurt Huber, Münchener Hochschullehrer und Mitglied der "Weißen Rose". Was prädestinierte diesen Mann mit eher bescheidener akademischer Laufbahn zur lebensgefährlichen Konfrontation mit einem System, in das er anfangs durchaus Hoffnungen gesetzt hatte?
Eine fortdauernde Herausforderung bildet die Spannung zwischen der Vorbildlichkeit der einzelnen Widerstandshandlungen und deren bisweilen problematischen Motiven, zwischen dem Lob der Auflehnung und dem Befremden über manche zugrunde liegende Weltanschauung. Kurt Huber ist in dieser Hinsicht ein Paradefall, und es ist das Verdienst der Studie von Rosemarie Schumann, dass sie zwischen Hagiographie und Sensationshermeneutik den unspektakulären dritten Weg der wissenschaftlichen Rekonstruktion wählt, um vor allem Hubers geistige Welt und seine Arbeit als Wissenschaftler erstmals umfassend anhand der im Bundesarchiv zugänglichen Schriften und Briefe zu erschließen. Das ist ein mühsames Geschäft: Denn der 1893 in Chur geborene Huber war kein systematisch-stringenter Denker. Aus der Fülle seines Wissens destillierte er nur wenig, das gut zu lesen und akademisch vorzeigbar war. Letztlich zielte er auf utopische Restauration: Mit seinen Fächern Philosophie, Psychologie und Musikwissenschaft, Schwerpunkt Tonpsychologie und Volksliedforschung, suchte er nach der großen Synthese, die den Riss der Moderne heilen und eine christliche Sinngebung allen Wissens wiederherstellen sollte. Damit scheiterte er - am eigenen Ungenügen ebenso wie an den weltanschaulichen und wissenschaftspolitischen Rahmenbedingungen seiner Zeit.
Dass Huber beruflich nicht weiterkam und auch nach dem Ende der von ihm verachteten Weimarer Republik keinen Lehrstuhl erhielt, musste ihn umso mehr erschüttern, als er den Nationalsozialismus eine Zeitlang für geistesverwandt gehalten und sich von dort eine Renaissance jenes altgermanischen Rechts- und Gefolgschaftswesens erhofft hatte, das für ihn das Ideal des deutschen Volkstums darstellte. Rosemarie Schumann bemüht sich, trotz des Gleichklangs der Terminologien die Unterschiede zwischen Hubers romantischer, an Herder geschulter Volkskunde und dem rassistischen "Volk"-Begriff des Nationalsozialismus deutlich zu machen - und tatsächlich scheinen diese Unterschiede auch den neuen Machthabern bewusst gewesen zu sein, denn es nutzte Hubers Karriere nach 1933 eben nichts, dass er das inzwischen sehr modisch gewordene Feld der Volkstumsforschung und besonders der Volksmusikkunde schon seit langem wissenschaftlich beackert hatte.
Das Volkslied, dem seine ganze Passion galt, entsprach nun einmal nicht dem "braunen Massensingen". Umgekehrt ergibt sich mit Blick auf Hubers Umfeld ein deprimierendes Bild von der Anpassungswilligkeit der universitären Eliten gegenüber den neuen Herren. Minutiös verzeichnet Frau Schumann, wie sich im vergifteten Klima des deutschen Hochschulbetriebs wissenschaftliche und ideologische Attacken gegen Huber wechselseitig Nahrung boten. Allerdings verzettelt sich die Autorin bei dem Versuch, Kurt Hubers Positionen und berufliche Stationen in München und Berlin in ein Gesamtpanorama der Forschung und Lehre an der Wende zur Diktatur und im totalitären Staat einzuordnen. Auf diese Weise werden zwar spannende, bedrückende Kapitel deutscher Wissenschafts- und Universitätsgeschichte angerissen - aber das Kaleidoskop aus Spezialthemen und Zeitgenossen, die vorgestellt werden, auch wenn sie Hubers Weg nur von ferne streifen, ergibt noch keine kohärente Lebensgeschichte dieses Mannes. Und doch muss es da eine Konstante, ein tragendes Fundament gegeben haben, das ihm die Standhaftigkeit verlieh, im Frühjahr 1943 seinen Anklägern zu sagen: "Die innere Würde des Hochschullehrers, des offenen, mutigen Bekenners seiner Welt- und Staatsanschauung kann mir kein Hochverratsverfahren rauben."
Rosemarie Schumann zeigt plausibel, dass die Bereitschaft zum nichtkonformen Denken konstitutiv für Hubers gesamte Existenz war. Seine Unversöhnlichkeit gegenüber dem Zeitgeist, die ihn schon vor 1933 zum akademischen Außenseiter hatte werden lassen, blieb ihm unter der Diktatur erhalten. Man hat bisweilen unterstellt, er sei aus Enttäuschung über eine verhinderte Hochschulkarriere zum rebellischen Hasardeur geworden. Frau Schumann dokumentiert etwas anderes: Huber war und blieb - von seinen Studenten bewundert und geliebt - ein Mann des klaren Bekenntnisses und des Einspruchs aus christlich-restaurativer Gesinnung.
CHRISTIANE LIERMANN
Rosemarie Schumann: Leidenschaft und Leidensweg. Kurt Huber im Widerspruch zum Nationalsozialismus. Droste Verlag, Düsseldorf 2007. 632 S., 54,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main