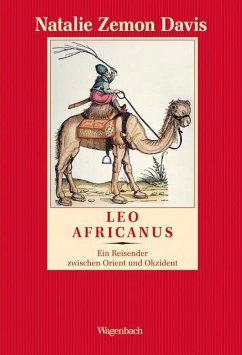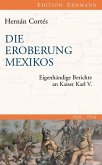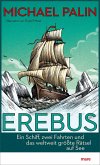Die große Historikerin Natalie Zemon Davis erzählt die exemplarische Lebensgeschichte des Leo Africanus wie einen Abenteuerroman:als Muslim geboren, von Katholiken vertrieben und vom Papst getauft...
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Natalie Zemon Davis schreibt mit "Leo Africanus" eine Antwort auf Samuel Huntington.
Von Nils Minkmar
Ein Vogel, der auch schwimmen kann, beschwert sich bei den Fischen: Der König der Vögel wolle ihn besteuern, dabei sei er doch einer von ihnen, ein Fisch. Also wohnt er so lange unter den Fischen, bis die Steuer beim König der Fische fällig wird, dann fliegt er steil in den Himmel empor, zu seinen gefiederten Verwandten und lebt unter denen, so lange, bis auch dort die Steuer fällig ist.
Der frühneuzeitliche Kosmograph Leo Africanus, geboren um 1487 in Granada und nach der Reconquista im marokkanischen Fez aufgewachsen, zitiert diese Parabel in seiner 1550 erschienenen Descrittione dell Africa, der ersten neuzeitlichen Beschreibung des Kontinents. Sie stamme, erläuterte er seinen Lesern, aus jener berühmten Sammlung arabischer Weisheit, dem "Buch der Hundert Geschichten". Er zitiert sie in programmatischer Absicht: Diese in der Parabel anklingende Möglichkeit einer zweiten Perspektive auf die Welt solle ihn bei der Arbeit an seinem Buch leiten: "Ich werde es machen wie der Vogel. Wenn die Afrikaner geschmäht werden, wird der Verfasser klar und deutlich zu verstehen geben, dass er nicht in Afrika, sondern in Granada geboren wurde. Und wenn die Leute aus Granada gegen ihn aufgebracht sind, wird er darauf hinweisen, dass er nicht in Granada aufgewachsen sei."
Er war einer der am meisten zitierten Autoren seiner Zeit.
Dies werde ihm erlauben, ohne Rücksicht auf Höflichkeiten auch Dinge zu schildern, die nicht so schön seien, ohne der Nestbeschmutzung angeklagt werden zu können. Er wolle sich, so zitiert er ein weiteres Mal das "Buch der Hundert Geschichten", so verhalten wie jener Scharfrichter, der seinen besten Freund auspeitschen musste. Der hoffte, einigermaßen gnädig davonzukommen, doch der Scharfrichter schlug im Gegenteil besonders fest zu, denn er müsse, sagte er dem Freund anschließend, eben "seine Pflicht tun". Das klingt sehr erbaulich, geradezu politisch korrekt, so viele Jahrhunderte vor unserer Zeit. Und doch ist an der Sache ein Haken: Es gibt kein "Buch der Hundert Geschichten" aus dem arabischen Raum. Die schönen Geschichten aus alter Weisheit, die dem Autor als Ausweis seines guten Willens dienen - die hat er selbst erfunden.
Wer hätte ihm auf die Schliche kommen können? Wer unter seinen Zeitgenossen hätte die Literaturlage in der arabischen Welt so gut kennen sollen, um auszuschließen, dass nicht doch irgendwo so ein Buch existiert? Und welcher gebildete Mensch der Renaissance hätte riskieren wollen, als Ignorant dazustehen, der von dieser legendären Quelle orientalischer Weisheit noch nichts gehört hat, als Einziger in ganz Rom?
Da musste sich schon eine Historikerin an die Arbeit machen, die die gesamte Geschichtenproduktion zunächst in Europa, später auch im Maghreb und im arabischen Raum studiert hat, die also zu ihrer stupenden Kenntnis der französischen, englischen, deutschen und italienischen Bibliotheken auch die Lage in Marokko, Tunesien, Ägypten und Andalusien einzuschätzen lernte. Da musste erst Natalie Zemon Davis kommen, die, seit vielen Jahrzehnten schon weltberühmt, mit achtzig Jahren ihr ambitioniertestes Buch vorlegt.
Davis legt dar, dass es zwar die Geschichten aus Tausendundeiner Nacht gab, von der die Gebildeten vom Hörensagen wussten, aber in ihnen lässt sich weder ein amphibischer Vogel noch ein plichtbewusster Scharfrichter finden. Es gibt das Decamerone, das sich ganz ähnlich anhört, aber auch dort keine dieser Geschichten. Es ist einfach ein Trick des Autors. Es ist ein außergewöhnliches historiographisches Wagnis, sich der Biographie dieses religiös, sozial und geographisch hochmobilen Tricksers zu nähern. Denn obwohl Leo Africanus einer der am meisten zitierten Autoren seiner Zeit war und jeder Renaissancewissenschaftler ihn und seine Beschreibung Afrikas kennt, gibt es so gut wie keine Quellen über ihn. Keine Briefe, keine Erwähnungen, keine Zeitzeugenberichte, bloß die Bücher, ja - und ein- oder zweimal hat er seinen Namenszug in Bände geschrieben, die er aus der Vatikanischen Bibliothek entliehen hatte. Mehr nicht.
Schon der Name ist Teil des Problems: Leo Africanus ist der Autorenname, unter dem er etwa in Deutschland bekannt ist. Der Geburts-und Familienname lautet al Hassan al Wazzan. Taufname wiederum ist Joannes Leo de Medici. Die Autorin aber führt ihn unter der arabischen Fassung des italienischen Namens, also heißt der Mann im Buch durchweg Yuhanna Al Assad. Es ist wie mit den Fischen im Mittelmeer: an jeder Küste, auf jedem Fischerboot tragen sie einen anderen Namen und sind doch immer dieselben Tiere.
Sie nimmt die Ausweichmanöver der Menschen in den Blick.
Auch Leo Africanus wurde von den falschen Leuten aufgefischt: 1518 schnappen ihn christliche Piraten, als er von einer diplomatischen Mission in Kairo nach Marokko zurückfährt. Sie erkennen die umfassende Bildung des Mannes und führen ihn zu Papst Leo X., der ihn in christlicher Lehre unterweisen und konvertieren lässt. Leo alias Yuhanna versteht sich in Rom als Mittler. In Zeiten der osmanischen Expansion versucht er, die Fremdartigkeit und die Nähe Afrikas und des Islams plausibel zu machen. Er arbeitet an diversen Wörterbüchern und Kompendien, wird zum gefragten Experten für den Islam und Afrika. Und doch nutzt er die Gelegenheit, nach dem Sacco di Roma in seine Heimat zurückzukehren, in Marokko wechselt er abermals den Namen, die Spuren verlieren sich. Das Buch rührt an Probleme, die auch in der "Wiederkehr des Martin Guerre", dem Werk, das die Autorin weltberühmt machte, anklingen: Wie identifiziert man in Zeiten, in denen es keine Fotografie, keine Personalausweise und keine DNS-Tests gibt, einen Menschen, und wie soll es die Historikerin so viele Jahre später anstellen?
Natalie Zemon Davis hat mit Leo Africanus die intellektuell ambitionierte Antwort auf Samuel Huntingtons "Clash of Civilizations" geschrieben. Sie eröffnet dem Leser ohne pompöses theoretisches Brimborium den Entwurf einer Wissenschaft, die die Tricks, die Wandlungen und Ausweichmanöver von Menschen und Texten in den Blick nimmt. Das Flüchtige erscheint normal, der Mittler zwischen Christentum und Islam ist eine stetigere und zuverlässigere Figur als der eifernde Prediger.
Natalie Zemon Davis: "Leo Africanus". Ein Reisender zwischen Orient und Okzident. Aus dem Englischen von Gennaro Ghirardelli. Wagenbach Verlag, Berlin 2008. 400 S., Abb., geb., 36,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Judith von Sternburg preist Natalie Zemon Davis' in ihrem Buch über Leo Africanus unter Beweis gestellte unerhörte Belesenheit und schwärmt von der Gabe der Autorin, sowohl interessante Details als auch das große Ganze faszinierend zu beleuchten. Die gerade 80 Jahre alt gewordene amerikanische Historikerin lässt uns den in Nordafrika als Moslem aufgewachsenen Leo Africanus, der 1518 Papst Leo X. geschenkt wurde, als listigen Diplomaten sehen, der sich sowohl in der arabischen wie in der westlichen Welt zu behaupten wusste, stellt die Rezensentin fest. Wie Leo Africanus selbst, dessen berühmtestes Werk ein Buch über Afrika ist, weiß auch die Autorin, was die westlichen Leser fesselt, so Sternburg anerkennend, die sich deshalb auch gern von Davis durch die "fremden Welten" des 16. Jahrhunderts führen lässt. Und wenn die Autorin Leo Africanus dann eine "innere Verwandtschaft" mit dem französischen Erzähler Rabelais attestiert, mit dem sie in einem Epilog ein fiktives Zusammentreffen arrangiert, dann wird die Denk- und Schreibweise des Leo Africanus auch für den "europäischen Leser" vertraut, so die Rezensentin gefesselt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH