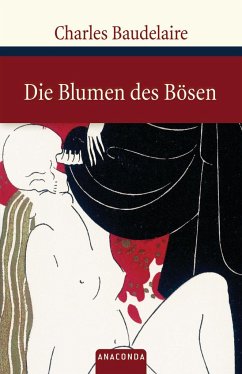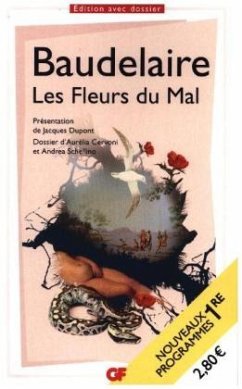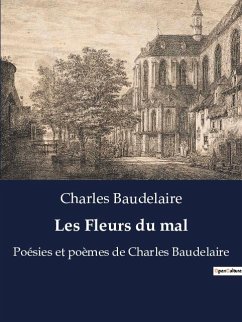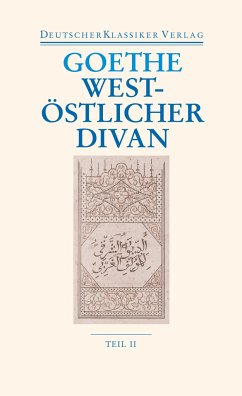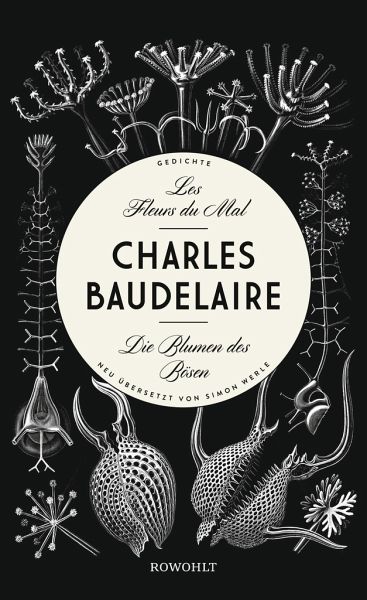
Les Fleurs du Mal - Die Blumen des Bösen
Gedichte. Neu übersetzt von Simon Werle
Übersetzung: Werle, Simon

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Les Fleurs du Mal - Die Blumen des Bösen von Charles Baudelaire, dem bedeutendsten Dichter Frankreichs, ist ein Werk, das die europäische Lyrik nachhaltig geprägt hat.Bei seinem Erscheinen 1857 in Frankreich sorgte der Gedichtzyklus für einen riesigen Skandal, wurde mehrfach verboten und verbrannt. Doch gerade dadurch wurde er zu einem zentralen Text der Moderne. Baudelaire analysiert in den "Blumen des Bösen" schonungslos das Dämonische, das an der Wurzel jeder existentiellen Erfahrung lauert. Mit ihrer Sprachmagie, ihren Exorzismen der Verzweiflung, ihrer Ästhetisierung des Makabren, ...
Les Fleurs du Mal - Die Blumen des Bösen von Charles Baudelaire, dem bedeutendsten Dichter Frankreichs, ist ein Werk, das die europäische Lyrik nachhaltig geprägt hat.
Bei seinem Erscheinen 1857 in Frankreich sorgte der Gedichtzyklus für einen riesigen Skandal, wurde mehrfach verboten und verbrannt. Doch gerade dadurch wurde er zu einem zentralen Text der Moderne. Baudelaire analysiert in den "Blumen des Bösen" schonungslos das Dämonische, das an der Wurzel jeder existentiellen Erfahrung lauert. Mit ihrer Sprachmagie, ihren Exorzismen der Verzweiflung, ihrer Ästhetisierung des Makabren, Bizarren und Morbiden sowie ihrer gewagten Erotik markieren die Gedichte einen Höhe- und Wendepunkt der französischen Dichtung. Formal noch der Verskunst des Klassizismus und der Romantik verpflichtet, sprengen und überschreiten sie inhaltlich deren Modelle und erschließen völlig neue psychologische und soziologische Dimensionen.
Diese zweisprachige Neuübersetzung anlässlich des150. Todestages von Charles Baudelaire macht das bahnbrechende Werk einem breiten deutschsprachigen Publikum zugänglich.
Bei seinem Erscheinen 1857 in Frankreich sorgte der Gedichtzyklus für einen riesigen Skandal, wurde mehrfach verboten und verbrannt. Doch gerade dadurch wurde er zu einem zentralen Text der Moderne. Baudelaire analysiert in den "Blumen des Bösen" schonungslos das Dämonische, das an der Wurzel jeder existentiellen Erfahrung lauert. Mit ihrer Sprachmagie, ihren Exorzismen der Verzweiflung, ihrer Ästhetisierung des Makabren, Bizarren und Morbiden sowie ihrer gewagten Erotik markieren die Gedichte einen Höhe- und Wendepunkt der französischen Dichtung. Formal noch der Verskunst des Klassizismus und der Romantik verpflichtet, sprengen und überschreiten sie inhaltlich deren Modelle und erschließen völlig neue psychologische und soziologische Dimensionen.
Diese zweisprachige Neuübersetzung anlässlich des150. Todestages von Charles Baudelaire macht das bahnbrechende Werk einem breiten deutschsprachigen Publikum zugänglich.