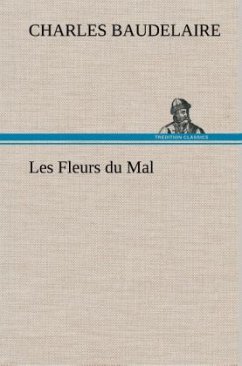Cette uvre (édition relié) fait partie de la série TREDITION CLASSICS. La maison d édition tredition, basée à Hambourg, a publié dans la série TREDITION CLASSICS des ouvrages anciens de plus de deux millénaires. Ils étaient pour la plupart épuisés ou uniquement disponible chez les bouquinistes. La série est destinée à préserver la littérature et à promouvoir la culture. Avec sa série TREDITION CLASSICS, tredition à comme but de mettre à disposition des milliers de classiques de la littérature mondiale dans différentes langues et de les diffuser dans le monde entier.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.