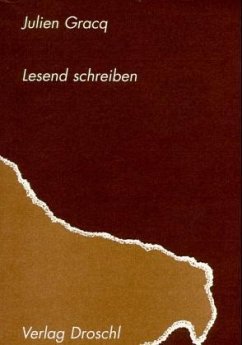Produktdetails
- Verlag: Literaturverlag Droschl
- Seitenzahl: 280
- Abmessung: 210mm
- Gewicht: 434g
- ISBN-13: 9783854204480
- Artikelnr.: 08060392

Julien Gracqs kulinarische Grand Tour auf dem Terrain des Lesens
Um 1800, in den Jahren der deutschen Frühromantik, begannen die Schriftsteller, eine besondere Sprache für den Umgang mit Büchern zu erfinden. Diese Sprache war eine der Lesefrüchte, des genußvollen und doch nur sporadischen Blicks auf die Werke. Friedrich Schlegel oder Novalis notierten ihre Eindrücke, schrieben knappe Aphorismen oder bündelten ihre Einsichten in glänzend formulierten Fragmenten. So entstand ein von Inspirationen lebender Umgang mit Büchern, der die Kategorien der herkömmlichen, gelehrten Literaturkritik ganz vernachlässigte.
Denn es ging diesen Schriftstellern nicht darum, ein breites Publikum zu unterrichten oder gar zu belehren. Statt dessen suchten sie eine geheime Verständigung untereinander, den verborgenen Dialog darüber, was Literatur sei und wie sie sich verändere. Im Mittelpunkt dieses Dialogs stand das Metier des Schreibens, der Blick auf das Handwerk. Werke gleichsam handwerklich zu begreifen bedeutete, sie von innen, aus den Problemen ihrer Komposition, zu verstehen. Jeder Schriftsteller kennt diesen einzigartigen Blick auf das Werk eines anderen: Es ist ein Blick, der die Entstehung eines fremden Werks ahnend nacherlebt, ein mißtrauischer, unruhiger Blick auf Stärken, Halbheiten und Schwächen.
Von diesen Einsichten drang im Verlauf der Jahrhunderte immer weniger nach außen. Die deutschen Schriftsteller haben sich abgewöhnt, über die Geheimnisse anderer nachzudenken. Wenn sie Literaturkritiken schreiben, passen sie sich oft den längst gängigen Mustern der Kritik an und bilanzieren fürs Publikum. In Frankreich aber ist alles ganz anders. Dort nämlich hat sich das passionierte, die Aromen der Literatur skizzierende Schreiben ununterbrochen erhalten. Die Aufzeichnungen "Lesend schreiben" von Julien Gracq, unter dem Titel "En lisant en écrivant" 1980 in Frankreich erschienen, sind ein klassisches Endprodukt dieser langen Tradition.
Wie schwere Gongschläge hallen die Überschriften der sechzehn Abschnitte: "Literatur und Malerei", "Landschaft und Roman", "Das Schreiben", "Lesen", "Lektüren", "Sprache". Was darunter an Reflexionen erscheint, ist durch solch große Begriffe kaum noch zu fassen. Im Grunde handelt es sich um einen einzigen Monolog: Julien Gracq, der alte Weise der französischen Literatur, inspiziert die Terrains seines Lesens. Diese Inspektionen haben nun aber so gar nichts Schweres oder Programmatisches. Es sind vielmehr erweiterte Einfälle und ausgesponnene Gedanken eines Schriftstellers, dem es um die Genauigkeit der inneren Empfindungen geht. Bücher werden hier erlebt und gekostet, als verströmten sie wie schwere und kostbare Weine dichte Aromen. Gracq schmeckt nach, probiert, läßt sich Passagen auf der Zunge zergehen. Das alles ist aber nicht geschrieben, um Lesern auf die Sprünge zu helfen. In der Substanz ist dieses Schreiben vielmehr ganz und gar privat, vom Charakter her Tagebüchern oder persönlichen Geständnissen vergleichbar.
In Deutschland ist dieses Private oft anrüchig. Wittert man irgendwo Urteil und Geschmack eines sich offenbarenden einzelnen, wird er von der literarischen Sozialkontrolle schnell in Reih und Glied verwiesen. In Frankreich hat dieses Private etwas Stolzes, Triumphierendes, Prunkendes. Es macht auch oft Sensation, da sich dort Leser daran erfreuen, wie spitz und treffend die Schriftsteller sich gegenseitig beäugen.
Gracq treibt dieses Beäugen weit zurück. Er behandelt Balzac, Flaubert oder Stendhal so, als säßen sie gleich um die Ecke und als seien ihre Werke gerade erschienen. Die drei Großen bilden, ergänzt noch um Proust, das eigentliche Futter, von dem sein Wissen sich nährt. Nirgends, nicht im geringsten Nebensatz, wird dieses Wissen akademisch. Auch die erhabenen Werke der Tradition sind Steinbrüche, aus denen sich die Leidenschaft erst zu bedienen lernen muß. Was sie ermittelt, sind blitzhafte Ideen, denen eine forschende Sprache dann nachgeht. Etwa: "Im Grunde verzichtet Balzac bei seinen Vergrößerungsverfahren nie auf die Anliegen, die der Karikaturist verfolgt: Wirklichkeitstreue, Flinkheit, Intuition, Hervorhebung des entscheidenden Zugs, aber auch Verzerrung und systematische Akzentsetzung im Hinblick auf den Effekt . . ."
Solche Sätze ruhen auf langem, nicht weiter beschriebenem Lesen. Sie bilden gleichsam den Abhub, etwas Essenzhaftes, Anschauliches und auf seltsame Weise Sinnliches, das sich einer konzentrierten, sammelnden Wahrnehmung verdankt. Der Leser wird so mit Perlen der Beobachtung unterhalten, er wird hineingezogen in eine beinahe süchtig machende Sprache der steten Vergewisserung ästhetischer Effekte. Julien Gracqs großer Literaturmonolog wirkt dadurch im wörtlichen Sinne belebend. Gerade weil er privat spricht, appelliert er an die privaten Regungen des Lesers, die so lange versteckt oder gar unterdrückt waren. Unwillkürlich gerät man daher bei der Lektüre dieses reichen und üppigen Buches ins konkrete Träumen: man fragt sich nach den eigenen Leseeindrücken, man versucht sie genauer zu fassen, man denkt sich Begründungen aus.
Im "Deutschland"-Kapitel etwa erlebt man so eine Wiederbegegnung mit den eigenen Goethe-Lektüren. Gracq notiert das Skizzenhafte von Goethes Erzählen, das so viele Momente des Erzählgewebes abstrakt bleiben läßt: "Es gibt so gut wie keine Schriftsteller, die in der Fiktion ärmer an wahrheitsgetreuen kleinen Details sind." Und er folgt dieser Beobachtung bis hin zur Vermutung: "Vielleicht ist diese enttäuschende Unschärfe, die Goethe um das Detail im Roman anlegt, ein Schutzreflex gegen seine Ungeschicklichkeit bei der konkreten Erfindung, die bei ihm immer etwas Steifes besitzt."
Das sind charakteristische Sätze dieses stets anschaulich bleibenden Denkens, das an anderen Stellen - nicht in demselben Maße exakt, dafür aber reizvoll - Vermutungen zu Goethes Biographie anstellt: "Was für eine schöne Literaturfiktion könnte man schreiben: der früh lungenkranke Goethe, der, anstatt auf die Gefriertruhe in Weimar, direkt auf Italien zusteuert! Und - Werther und der Götz sind immerhin die Garanten dafür - mit einem Schlag würde das ganze Werk des Gründungsvaters der deutschen Literatur nicht mehr so penetrant nach kaltem Kalbfleisch mit Mayonnaise schmecken."
Solch schöne Bosheiten vergißt man nicht, sie sind gleichsam das Dessert zu all den funkelnden Überlegungen, die Gracq auf höchstem Niveau, stets mit allen Sinnen präsent, stets der vornehme Führer durch das wiederzubelebende Reich der Toten, ausstreut. Im ganzen haben diese Aufzeichnungen daher etwas von langen Reisen, in den traditionellen Tempi der Grand Tour längst vergangener Jahrhunderte. Es sind Augentempi, die keine willkürliche Beschleunigung und kaum eine Einmischung von Technik vertragen.
Um sie erlebbar zu machen, hat Gracq eine wunderbar melodiöse und doch haftende Sprache erfunden (deren Charakter die Übersetzung von Dieter Hornig sehr gut trifft). Es ist, als erlebte man durch diese Sprache das Gewahrwerden, das Staunen, Herumstreunen und Loswandern. Die Nebensätze durchweben die Leitgedanken der Hauptsätze wie feine Fäden, kleine Extravaganzen - Fremdwörter, seltene Benennungen - sind eingestreut wie Schatzspuren, die der Leser sich erst selbst erschließen muß.
So lebt in diesem unvergleichlichen, betörenden Buch die Sprache Prousts. Gracq rettet ihren Nachhall in unsere Zeit, noch in der Nachahmung des kulinarischen Gestus, der von der Literatur nichts anderes will als den höchsten Genuß: die Verschränkung von Gedanke und Traum, die Geschichte als Märchen des Geistes. HANNS-JOSEF ORTHEIL
Julien Gracq: "Lesend schreiben". Aus dem Französischen übersetzt von Dieter Hornig. Literaturverlag Droschl, Graz und Wien 1997. 280 S., geb., 44,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main