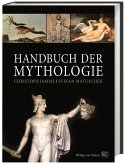Wenn es eine Gedächtniskunst gibt, sollte es dann nicht auch eine Kunst des Vergessens geben? Wieviel Vergessen braucht oder verträgt eine Kultur, und wann überschreitet die Vergeßlichkeit die Grenzen der Moral? Auf solche Fragen kann besser antworten, wer sich mit der Kulturgeschichte des Vergessens vertraut gemacht hat. Diese Geschichte legt Harald Weinrich hier vor - ebenso gelehrt wie stilistisch brillant geschrieben, ebenso unterhaltend wie zum Nachdenken einladend.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Lethe, der Fluß ohne Wiederkehr: Harald Weinrich unternimmt eine Bildungsreise stromabwärts / Von Franziska Augstein
Wer viel erlebt hat, schreibt seine Erinnerungen. Darin entleeren die Leute ihr Gedächtnis, und die Welt hat später ein Andenken an sie. So wissen wir, daß Katharina die Große als Kind beinahe von einem Schrank erschlagen worden wäre. Und Julien Green war überzeugt, der Teufel stecke im mütterlichen Kleiderkasten. Menschen mit verwirrtem Verstand haben "nicht alle Tassen im Schrank" und auch sonst vieles verloren. Nicht umsonst galt die Vergeßlichkeit früher als Anzeichen für Geisteskrankheit. In der Alltagssprache werden Eindrücke und Vorurteile "in Schubladen" sortiert. Gelegentlich schnellen sie da heraus und erschrecken die Leute wie die Springteufel; meistens muß man sie freilich mühsam hervorkramen.
Im klassischen Metier des Erinnerns - der Mnemotechnik - wurde die Fülle des Wissens in der Phantasie räumlich sortiert, in Kästen, Zimmer oder Landschaften. Bei der Rekapitulation schritt die Erinnerung einen Ort nach dem anderen ab und sammelte die dort verwahrten Dinge ein. Die Gabe der Erinnerung wird seit jeher als einer der Wesensunterschiede zwischen Mensch und Tier angesehen. Nicht nur um Bildung dreht es sich dabei, sondern auch um den Entschluß zur wirtschaftlichen Vorratshaltung und darüber hinaus um die Moral. Die eigenen Sünden und erfahrenen Wohltaten nicht zu vergessen, hat immer als oberste Menschenpflicht gegolten.
Daß wir etwas buchstäblich vergessen sollen, hat hingegen kein Moralist je ernsthaft gefordert. Es hängt auch damit zusammen, daß der Mensch nicht Herr darüber ist, was er nicht im Kopf behält. Die Lethe, den Fluß des Vergessens, können wir uns zwar als einen sanften Strom vorstellen, aber nicht umsonst lag er bei den Griechen an der Grenze zwischen dieser Welt und dem Jenseits. Menschen sind sterblich - Gedanken fallen dem Vergessen anheim. Es ist das geistige Pendant zur physischen Auslöschung: der Tod des Gedankens. Und genau dafür bricht Harald Weinrich eine Lanze, indem er die Geschichte von der allmählichen Rehabilitierung des Vergessens in der Weltliteratur erzählt. Bei allem Verständnis für die Sprunghaftigkeit des Zeitgeschmacks ist diese Themenwahl doch bemerkenswert.
Überall, wo man deutsch spricht, ist heutzutage ein Satz zu hören, der aus dem Englischen übernommen ist: "Das kannst du vergessen." Für Weinrich ist er beredter Ausdruck der Wandlung, die das Vergessen seit der Antike durchgemacht hat: Einst als Nachlässigkeit der Erinnerung verpönt, sei es nun eine legere Kapriole, die dem Seelenhaushalt Entlastung gewähre und "alle Beteiligten in eine entspannte Stimmung versetzt".
Daß das Vergessen heutzutage für Schlagworte gut ist, unterstützt des Buches Grundgedanken: Wenn das Gedächtnis eine Wissenschaft ist, so sei das Vergessen zur Kunst geworden. Die Erinnerung ist die Pflicht der braven Leute, das Vergessen hingegen eine Kür für Weltweise oder Lebenskünstler und Vademecum der Gegenwart. Weinrichs "Lethe" ist eine Kollektion der literarischen Angenblicke, in denen Schriftsteller und Philosophen sich zum Vergessen bekannten, damit kokettierten oder es verteufelten.
Der Philologe und Naturwissenschaftler, der - für Ausländer ist das eine rare Ehre - am Collège de France Romanistik lehrt, vereinigt in sich die Tradition der deutschen Geistesgeschichte mit der französischen Vorliebe für Essayistik. In den Texten der kontinentaleuropäischen Sprachen weithin bewandert, läßt er die Vereinigten Staaten und England links liegen - das eine Land "ohne" Vergangenheit und Gedächtnis; das andere so stolz auf seine Tradition und ein so vehementer Gegner der Französischen Revolution, daß seine intellektuellen Wortführer die Einfallslosigkeit zur nationalen Tugend erklärten.
"Kunst und Kritik des Vergessens" ist schön geschrieben, ist unterhaltsam und vermittelt ein klassisches Gut: die Freude am Wissen. Nur eine "Kritik" ist es eigentlich nicht. Seine Auswahl literarischer Episoden durchwirkt Weinrich mit heideggerisierend gesponnenen Erklärungen zur Wortgeschichte des deutschen "Vergessens" und seiner griechischen Entsprechung. Metaphorische Arabesken anhand von Ausdrücken wie "ehrvergessen" oder "vom Winde verweht" wechseln sich ab mit anekdotischen Erzählungen aus der Geistesgeschichte. Gelegentlich scheint der philosophische Kontext durch das Material der Darstellung.
Das in sich geschlossene Bild einer Tapisserie entsteht dabei nicht. Statt dessen entwickelt sich der Text, wie ein roter Teppich sich entrollt. Der führt von der Antike in die Gegenwart. An seinem Ende liegt aber kein Festsaal, da steht kein Flugzeug, dem als VIP des Abends die Gestalt gewordene Lethe entstiege. Man folgt Weinrichs erzählerischen Gedankengängen gern, aber bis zum Ende wundert man sich darüber, daß er das Vergessen zum Thema gemacht hat.
Das Ereignis, nach dem die Rolle des Vergessens bis auf weiteres taxiert werden muß, ist die Shoah. Auch nach Auschwitz konnten Gedichte geschrieben werden, es hatten die Autoren das Gedächtnis der Shoah ja im Kopf. Bisher ist das Bekenntnis zur Erinnerung ein kulturelles Einvernehmen und politischer Konsens gewesen, dank dessen die Deutschen untereinander und mit anderen haben reden können. In der öffentlichen Sphäre errichtet und bewacht, ist es einer der Grundpfeiler der bundesrepublikanischen Identität.
Weniger eklatant, aber nicht minder nachhaltig wirkt das Gedenken der Vernichtung auch in anderen Ländern: Die Beurteilung der Moderne und das Resümee des zwanzigsten Jahrhunderts stehen, wie überhaupt alle Wissenschaft, im Zeichen der Shoah. Sie prägt das Selbstverständnis der Nationen und kultureller Interessengemeinschaften. Der liberalen jüdischen Traditionspflege in Nordamerika zum Beispiel wird nachgesagt, sie beziehe ihren Impetus immer weniger aus der Kultur und immer mehr aus der Erinnerung an den Holocaust. Die Wiedervereinigung hat die moralische Verfaßtheit der vormaligen zwei deutschen Staaten erschüttert. Ob in Sorge oder mit Frohlocken - allenthalben wird erwartet, daß das Verhältnis der Deutschen zu ihrer Geschichte sich ändere. Harald Weinrich macht sich nicht mit den Leuten gemein, die von der Vergangenheit nichts mehr hören wollen. Die Shoah nimmt er, im Gegenteil, ausdrücklich von den Dingen aus, die dem "gnädigen Vergessen" preisgegeben werden möchten. Sein Buch fällt indes in eine Zeit, in der die Deutschen aus neuem Grund mit sich und miteinander hadern. War es früher die Zerrissenheit des Landes, ist es jetzt seine Einheit. Wie die vielen niveaulosen Vorwürfe gegen die Wehrmachtsausstellung gezeigt haben, empfinden manche Alte und manche Nachgeborene die Vergangenheit als lästig und möchten sie ad acta legen. Ist das auch nicht Weinrichs eigener Geist, so ist es doch der Geist der Zeit, in dem Weinrichs "Lethe" sich bespiegelt.
Seine Erfolgsgeschichte des Vergessens beginnt bei Homer, Platon, Cicero, Ovid und Augustinus. Immer heiter, immer leichtfüßig zieht Weinrich am Spalier der Autoren entlang. Ovid etwa empfahl allen verschmähten Liebenden die Kunst des Vergessens, die ars oblivionis: Sie sollten sich die Schattenseiten der Angebeteten vor Augen führen, sollten auf Reisen gehen und vor allem keine Liebesgedichte lesen - auch nicht seine, Ovids eigene Verse. Eine andere Methode überging der Dichter: Sie besteht darin, die Dinge, die vergessen werden sollen, schriftlich zu fixieren. Was im zwanzigsten Jahrhundert als therapeutische Maßnahme manchen Menschen nahegelegt wird, die sich von ihren Erinnerungen nicht befreien können, führte in Platons Augen zur geistigen Verarmung: Schreibst du die Dinge auf, hast du keinen Grund mehr, sie dir zu merken. Es war sein Kommentar zur Verschriftlichung.
Zur Labsal wurde das Vergessen Harald Weinrich zufolge aber erst viele Jahrhunderte später. In Dantes Inferno war die Lethe von der Grenze zum Hades an den Rand des Paradieses verlegt: Mit dem Übertritt in den Himmel entledigten die Seelen sich der Erinnerung an ihre Sünden zu Lebzeiten. Im Verlauf der Renaissance übersiedelten das Vergessen und seine Vorzüge in die Säkularität. Noch wurde es nicht eigens zur Sprache gebracht. Gleichwohl stellte Descartes' Denkweise in Weinrichs Worten "ihrer ganzen Konzeption nach eine umfassende Strategie des Vergessens" dar: Das "cogito ergo sum" habe sich aus dem Gedankenexperiment ergeben, das mit der Resolution des Philosophen begann, alle intuitive Kenntnis seiner selbst quasi zu vergessen.
Aus der Skepsis, mit der die Neuzeit dem angelernten Wissen gelegentlich begegnete, zieht Weinrich den Schluß, daß die Epoche "dem Vergessen eine gewisse Wahrheit" zugebilligt habe. Ein Moralist wie Montaigne habe das Vergessen zwar nicht unterstützt, vom Auswendiglernen hielt er aber auch nichts mehr. Sancho Pansa hat zwar ein viel besseres Gedächtnis als sein Herr, dafür ist er aber rechtschaffen einfältig. Leibniz ehrte die "Kunst des Er-findens" mehr als die "Kunst des Findens", die ihm an Originalität zu wünschen übrig ließ. In Juan Huartes humoralistisch-medizinischer Nationentypologie schnitten die Deutschen nicht besonders gut ab: "starkes Gedächtnis und wenig Verstand", befand der Spanier im sechzehnten Jahrhundert. Künftig galt: Wer sich den Kopf zu voll gestopft hatte, dem blieb kein Raum zum Denken übrig.
Die jungen Wilden der Aufklärung haben in diesem Punkt noch mit sich gehadert. Rousseau etwa "hatte sein Gedächtnis nicht so organisiert", daß er in den Pariser Salons stets das rechte Witzwort parat gehabt hätte. Vor dem urbanen Erinnerungsvermögen rettete er sich ins Grüne und in die anekdotische Beschreibung. Bei vielen Denkern der Aufklärung, schreibt Weinrich, könne man "von einem regelrechten Krieg zwischen der Vernunft und dem Gedächtnis sprechen", aus dem die erste allemal siegreich hervorgegangen sei.
Der aufgeklärte Verzicht auf das vollkommene Gedächtnis ging mit der Einsicht einher, daß kein Universallexikon alles Wissen der Welt enthalten konnte. Kommt das wirklich einem Lob des Vergessens gleich? Man fragt sich, wie der Mensch etwas vergessen kann, was er nie gelernt hat. Weinrich hat einen sehr breiten Begriff von dem Wort. Selbst den "Kauer" von Paris, der während der Französischen Revolution die Kriminalakten angeklagter Aristokraten beseitigte, indem er sie aufaß, hält er für einen Vertreter der ars oblivionis.
So großzügig hätte er gar nicht sein müssen. Das Vergessen ist auch so vielgestaltig genug. Mal ist es der kluge Gegenspieler des Erinnerns und mal nur sein tölpelhafter Widerpart, mal kommt es als gewitzter Diplomat im Dienst des Durchlavierens und dann wieder als der beste Arzt einer beschwerten Seele. Manchmal bleibt es auch ganz aus. Der Earl of Oxford konnte ein Lied davon singen: In Anwesenheit der Königin Elizabeth I. entfuhr seinem Hintern einmal ein Wind. John Aubrey berichtete, daß der Earl am Boden zerstört war und aus freien Stücken das Land verließ. Sieben Jahre lang wagte er nicht, seiner Königin unter die Augen zu treten. Als er sich schließlich doch ein Herz faßte, empfing sie ihn huldvoll: "Mein Herr, den Furz hatt' ich vergessen."
Hatte Elizabeth das Unvergessene vergeben? Oder war es ihre Pflicht als Dame, das Unerhörte irgendwann nicht mehr recht gehört zu haben? Manch ein Mann vergißt erst sich und dann die traurigen Folgen seiner Unrast. Casanova vergißt seine Geliebten und Goethes Faust den trüben Ausgang eines jeden neuen Abenteuers. Wer weiterkommen wolle, so Weinrich, müsse von nun an vergessen können und dürfe nicht zurückblicken. Das stimmt sicherlich, aber galt das nicht schon für Eurydike, gilt es nicht für jeden Machtmenschen, der über die Leichen seiner ehemaligen Weggefährten hinweg zur eigenen Inthronisierung strebt? Mitunter hat man den Eindruck, daß es vergebliche Liebesmüh ist, die verschiedenen Motive für das Vergessen in bestimmten Epochen verankern zu wollen.
Rabelais, Locke, Cervantes, Montaigne, Casanova, Voltaire, Chamisso, Thomas Mann, Pirandello, Thomas Bernhard - sie alle und viele mehr kommen vor; und wer sich nicht merkt, was Weinrich schreibt, ist selber schuld. Lethe, die am Anfang seiner Darstellung so wichtig ist, versickert allmählich in Wortspielereien. Die europäischen Hausmärchen kennen viele Nebenströme des Flusses. Hier spült ein Bach das Taschentuch mit den drei Blutstropfen der Mutter Königin davon - und mit ihm die Identität der Königstochter, die von der bösen Zofe nun als Gänsemagd traktiert wird. Dort duftet der Schlaftrunk, den der junge Soldat nach seinem Ritt zum Glasberg allabendlich von der falschen Frau gereicht bekommt; an seinem Bett sitzt dann des Nachts seine wahre Braut und klagt: "Trommler, Trommler, hör mich an. Hast du mich denn ganz vergessen? Hast du auf dem Glasberg nicht bei mir gesessen?" Und im dunklen Wald kommen Brüderchen und Schwesterchen an den Quell, der gluckst: "Wer aus mir trinkt, der wird ein Reh." Was gäbe es dazu nicht alles zu sagen?
Letztlich ist Lethe ihm nicht so wichtig wie die Karriere des Vergessens. Unter Freuds zweihundert Fachtermini findet sich der Begriff nicht. Immerhin gibt es das Unbewußte. Seit Freud, schreibt Weinrich, habe das Vergessen seine Unschuld verloren: "Von nun an muß einer, der etwas vergessen hat oder etwas vergessen will, sich rechtfertigen." Bis dahin galt das nur für Männer, die ihren Degen irgendwo liegengelassen hatten. Zugleich hält Weinrich das Vergessen seit dem späten neunzehnten Jahrhundert überhaupt erst für gesellschaftsfähig. Für moderne Romanciers sei es zur gesuchten Befreiung geworden. Ist das banale Wissensgut einmal ins Nirgendwo entsorgt, öffnet sich die Seele einer jenseits gelegenen Wahrheit.
Das galt auch für Marcel Proust. Im Dämmerlicht seiner Wohnung geborgen, kontrollierte er vorsichtig, welche Eindrücke der Außenwelt er einließ. Beim Schreiben strebte er nach der "genauen Dosierung von Erinnern und Vergessen". Erst indem die rationale, niedere Erinnerung der Dinge entschwand, konnte das "poetische Gedächtnis", konnte der Sinn für die Gerüche und Berührungen erwachen. Was sich nach Freud als leibliche Krankheit manifestierte, war für Proust, was Weinrich das "Gedächtnis des Leibes" nennt: "Die Proustsche Mnemopoetik", schreibt er in Anlehnung an Walter Benjamin, sei deshalb die "genaue Umkehrung" der Psychoanalyse. Anders als diese sucht sie das Heil im Abtauchen in die dumpfe, unformulierte Wahrnehmung.
Das Traumspiel von Phantasie und Schwärmerei widersteht der Institutionalisierung. So ist es kein Wunder, daß die Statthalter der Religion stets die größten Gegner des seligen Vergessens waren. Der Gott des Alten Testaments erhob die Hand gegen sein Volk immer dann, wenn Israel seine Gebote vergaß. Und die Gefangenen zu Babel klagten: "Vergesse ich dich, Jerusalem, so verdorre meine Rechte."
Keine Religion ist so sehr auf das Gedächtnis gebaut wie das Judentum. Der Historiker Yosef Hayim Yerushalmi hat diese Tradition dafür verantwortlich gemacht, daß die säkulare jüdische Geschichtsschreibung so spät, nämlich erst im neunzehnten Jahrhundert und mit dem Sterben Gottes, begonnen habe. So hätte denn das Gedächtnishandwerk der Historiographie in dem Moment seinen Anfang genommen, als das religiöse "Vergessen" einsetzte. Das gilt übrigens nicht nur für das Judentum, sondern auch für die christliche Bibelkritik.
Davon spricht Weinrich allerdings nicht - auf den Sprossen der Leiter, auf der er aus der Vergangenheit heraufsteigt, ist nicht genug Platz für ausschweifende Erkundungen. Immerhin erinnert er daran, daß auch das Christentum eine Gedächtnisreligion sei: Jesus trägt den Jüngern auf, das Abendmahl zu feiern "zu meinem Gedenken". An der besonderen Bedeutung des Erinnerns im Judentum ändert das freilich nichts. Elie Wiesels Kabbalist Kalman sagt darüber: "Wir sind uns dessen nicht immer bewußt, die anderen jedoch wohl. Und deshalb behandeln sie uns mit Mißtrauen und Grausamkeit. Das Gedächtnis macht ihnen angst."
"Vor diesem historischen Hintergrund", schreibt Weinrich, könne die Shoah "als unvergleichliches und beispielloses Attentat auf das kulturelle Gedächtnis der Menschheit" bezeichnet werden. So ungeheuerlich so ein Anschlag sein mag, wirkt er doch wie eine Bagatelle neben dem Verbrechen, die an den lebendigen Menschen begangen wurden, wie eine Bagatelle. Haben andere Völker etwa keinen Anteil am "kulturellen Gedächtnis der Menschheit"? Läuft nicht jeder Völkermord auf dessen Beschädigung hinaus? Auch unterschlägt Weinrichs Formulierung, daß in den Konzentrationslagern viele Menschen getötet wurden, die mit dem jüdischen Glauben ihrer Väter nichts zu tun hatten.
So unscharf er sich hier einer Pointe wegen ausdrückt, so merkwürdig schlicht wirkt sein Plädoyer für ein bißchen Vergessen nach der Shoah. Hier kommt das Buch in seine Krisis und die Methode der anekdotischen Paraphrase an ihre Grenzen. Weinrich zitiert "Nacht" von Elie Wiesel und aus Werken von Primo Levi, Jorge Semprún und Saul Bellow. Es sind eindrucksvolle Zeilen, indes enden sie alle in sich selbst, ohne daß der Autor ihnen mehr abgewönne, als sie besagen. Sie künden unter anderem von dem Wunsch, daß die Shoah nie vergessen werde, und bezeugen, daß die Überlebenden darunter leiden, wenn sie von ihren Erinnerungen an die Gefangenschaft im Lager ganz beherrscht werden.
Die Debatte über Holocaustmuseen, das Denkmal in Berlin und die Darstellung der Shoah im Film sind uns allen laut im Ohr - Weinrich fügt dem nur den therapeutischen Vorschlag hinzu, daß "vielleicht auch das Vergessen ein Daseinsrecht" habe: "Steht es wirklich ganz auf der Seite des Todes oder vielleicht auch ein bißchen auf der des Lebens?" So blaß formuliert, ist diese Frage längst entschieden. Unentschieden ist nur Weinrich, der die Rehabilitierung des Vergessens darstellen will und dann das eigene Programm notgedrungen verwässert, weil er es auf die Shoah nun einmal nicht anwenden kann.
"Schreib das auf, Kisch", rief man ehedem dem rasenden Reporter zu. "Für die Nachwelt" soll das Buchenswerte schriftlich festgehalten werden. So einfach sind die Dinge aber nicht. Wie Platons Skepsis angesichts der Verschriftlichung zeigt, waren sie es nie: Autoren suchen, sich Gedanken von der Seele zu schreiben. Die Moderne unterhält sich mit dialektischen Doppeldeutigkeiten: Wer etwas niederschreibt, will es mitunter nieder schreiben. Thomas Bernhard zum Beispiel wollte das. Weinrich beruft sich auf den Roman "Die Auslöschung". Er glaubt, Bernhard habe darin an den Opfern des Nazismus eine Art verbaler Wiedergutmachung stellvertretend für das verhaßte Anschlußland Österreich leisten wollen.
Wenn die Menschen sich ihrer Taten oder ihrer Leiden ausdrücklich erinnern wollen, dann bauen sie ein Denkmal. Wenn sie sie unbedingt vergessen wollen, dann leugnen sie ihre Existenz. So gesehen, war Thomas Bernhard kein Vertreter der ars oblivionis. Er war eben kein Wiedergutmacher. Nicht jede Form der Auslöschung kommt dem Vergessen gleich. Und umgekehrt dient nicht jedes Denkmal der Erinnerung.
Sofern die schriftliche Fixierung das Vergessen befördern kann, sollte sie möglichst routiniert und regelmäßig exekutiert werden. Eine Institution wie die bürokratische Verwaltung scheint dafür wie geschaffen. Tatsächlich ist das ihr ganzer Sinn: Je effizienter Daten sortiert, registriert und katalogisiert werden, desto weniger muß man an sie denken. Wohlwollend betrachtet, praktizieren Verwaltungsbeamte (wie auch die Programme der Datenverarbeitung) eine hohe Form der ars oblivionis.
Die hat aber nichts damit zu tun, daß sogar die öffentliche Hand nicht alle anfallenden Informationen aufbewahren kann. Sie hat auch nichts mit Weinrichs Bemerkung zu tun, daß die Wissenschaftler viele Veröffentlichungen zu ihrem jeweiligen Thema ignorieren müßten, wenn sie selbst auch noch etwas publizieren wollten. Im zweiten Fall geht es absonderlicherweise darum, etwas zu "vergessen", was man nie gewußt hat. Womöglich steckt in der Idee allerdings eine tiefere Wahrheit: Vielleicht ist das ihm Unbekannte das einzige, was der Mensch vollständig vergessen kann. Und alle übrigen Arten des Vergessens sind nur schwächere Formen der Erinnerung.
Harald Weinrich: "Lethe". Kunst und Kritik des Vergessens. C. H. Beck Verlag, München 1997. 336 S., geb., 58,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main