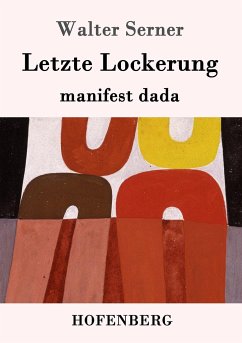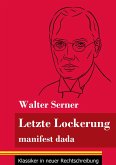Walter Serner: Letzte Lockerung manifest dada
Entstanden 1918. Erstdruck 1920 Hannover, Paul Steegemann. Anton van Hoboken gewidmet.
Neuausgabe.
Herausgegeben von Karl-Maria Guth.
Berlin 2016.
Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes: Sophie Taeuber-Arp, Gouache sur papier, 1918.
Gesetzt aus der Minion Pro, 11 pt.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Entstanden 1918. Erstdruck 1920 Hannover, Paul Steegemann. Anton van Hoboken gewidmet.
Neuausgabe.
Herausgegeben von Karl-Maria Guth.
Berlin 2016.
Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes: Sophie Taeuber-Arp, Gouache sur papier, 1918.
Gesetzt aus der Minion Pro, 11 pt.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.