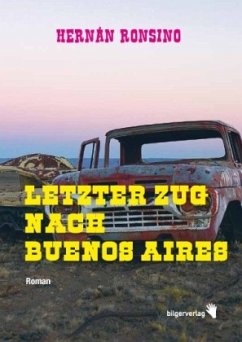Da ist zunächst ein Friseursalon. Von dort aus beobachtet Vicente, der Erzähler, die Welt. Er beobachtet die Arbeiter, die Gleise der Eisenbahn demontieren. Gleise, auf denen nie mehr ein Zug in dieses verlassene Provinzkaff, weit weg von Buenos Aires, einfahren wird. Gleise, die als Narben in der Erde und in den Köpfen der Einwohner zurückbleiben. Dann ist da das Don Pedrin, die Bar, in der alles kommentiert wird. Man spricht über den Film, der im einzigen Kino des Städtchens gezeigt wurde, und man spricht über das Vergangene und stellt immer wieder Fragen, warum die Negra Mlranda eines Tages den Zug nach Buenos Aires genommen haben soll und nicht mehr zurückgekommen ist? Sie hatte Beine, die jeden Mann, die jungen sowieso, um den Verstand brachten und einen verheirateten Polizisten durchdrehen ließen. Ob gedankenverloren oder im Gespräch mit anderen, jeder erzählt seine Version der Geschichte, verwischte Erinnerungen vom Verlassenwerden, von Rache und Abgründen der Geschichte ... und auf der letzten Zeile erst erschließt sich das Ganze der Geschichte.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Nach der Lektüre von Hernan Ronsinos schmalem Buch "Letzter Zug nach Buenos Aires" möchte Rezensentin Cornelia Fiedler am liebsten sofort von vorne beginnen. Denn Ronsino gelinge es in seiner Geschichte, in der mehr unausgesprochen bleibe, als erzählt werde und in der sich Formulierungen wie die Arbeitsroutine wiederholen, mit einfachen, "schnörkellosen" Sätzen eine derart subtile Spannung aufzubauen, dass sich die Kritikerin schnell in den Bann ziehen lässt. Ausgehend von dem Tatsachenbericht des Journalisten Rodolfo Walsh über "Das Massaker von San Martin" aus dem Jahre 1956, in dem Polizisten nach dem Sturz eine Gruppe unbeteiligter Zivilisten erschossen, liest die Rezensentin hier die von vier Beteiligten geschilderten, nachfolgenden Ereignisse der Jahre 1958 bis 1984: darunter einer der Polizisten, der nun in die Kleinstadt bei Buenos Aires strafversetzt worden ist. Lobend erwähnt die Rezensentin auch die Übersetzung von Luis Ruby, dem es gelinge, Ronsinos "schroffe" Bilder präzise wiederzugeben.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH