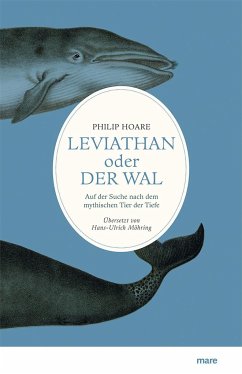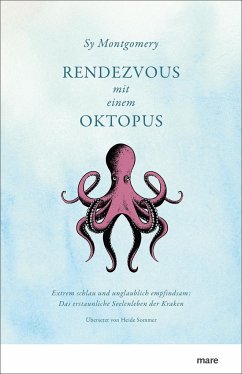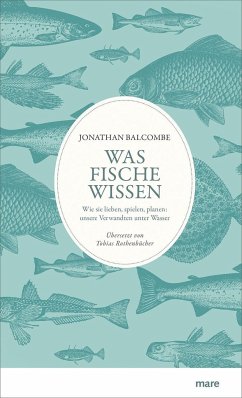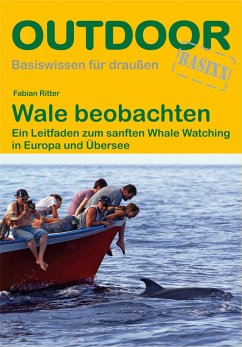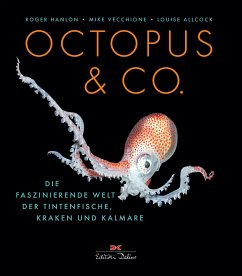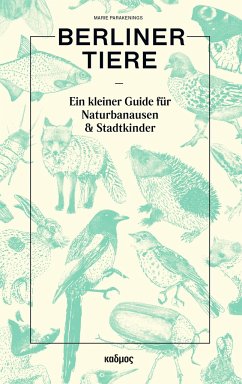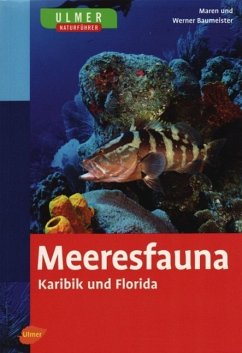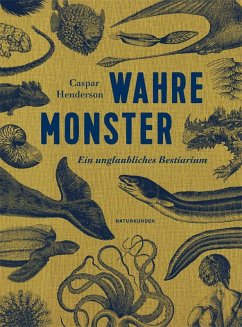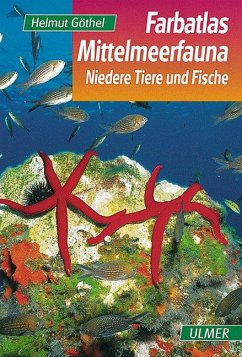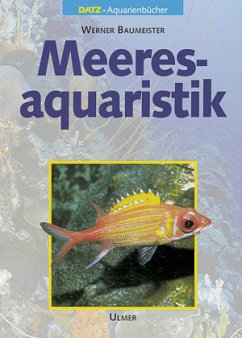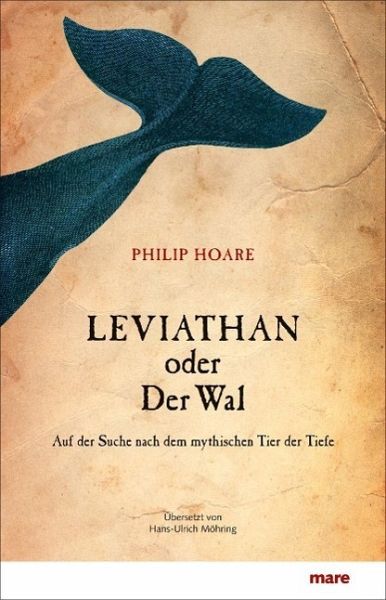
Leviathan oder Der Wal
Auf der Suche nach dem mythischen Tier der Tiefe
Übersetzung: Möhring, Hans-Ulrich

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
'Moby-Dick' ist ein Buch, das durch seinen Wal legendär wurde - aber umgekehrt wird ebenfalls ein Schuh draus: Seit der Roman von Herman Melville 1851 veröffentlicht wurde, hat man Wale mit anderen Augen gesehen. Aus einem bereits legendären, mythischen Tier schuf Melville einen modernen Mythos. Philip Hoare, seit jeher fasziniert von Walen, versucht in 'Leviathan' seiner Besessenheit auf den Grund zu gehen. Warum haben Wale eine so starke Anziehungskraft auf den Menschen? Warum spielen sie in unserer Fantasie immer wieder eine Rolle, verschmelzen darin mit dunklen Vorstellungen von Seeschl...
'Moby-Dick' ist ein Buch, das durch seinen Wal legendär wurde - aber umgekehrt wird ebenfalls ein Schuh draus: Seit der Roman von Herman Melville 1851 veröffentlicht wurde, hat man Wale mit anderen Augen gesehen. Aus einem bereits legendären, mythischen Tier schuf Melville einen modernen Mythos. Philip Hoare, seit jeher fasziniert von Walen, versucht in 'Leviathan' seiner Besessenheit auf den Grund zu gehen. Warum haben Wale eine so starke Anziehungskraft auf den Menschen? Warum spielen sie in unserer Fantasie immer wieder eine Rolle, verschmelzen darin mit dunklen Vorstellungen von Seeschlangen und anderen vorsintflutlichen Riesenwesen? Ist der Wal ein Symbol paradiesischer Unschuld in Zeiten der Artenbedrohung und des Klimawandels? Oder eher ein uraltes Sinnbild für das Böse schlechthin, ein bizarrer Fisch, der Jona verschluckt hat?
Besuche im Londoner Natural History Museum während der Kindheit, die erste (und die zweite) 'Moby-Dick'-Lektüre, zahlreiche Whale-Watching-Touren, eine Fahrt von Nordengland nach Cape Cod und zur Mitte des Atlantiks: Der Autor unternimmt nicht nur eine persönliche und biografische Reise, sondern auch eine (kultur-)historische; er erzählt seine eigene Geschichte einer Leidenschaft und liefert zugleich erhellende Antworten auf die Frage, was das Faszinosum Wal ausmacht.
Besuche im Londoner Natural History Museum während der Kindheit, die erste (und die zweite) 'Moby-Dick'-Lektüre, zahlreiche Whale-Watching-Touren, eine Fahrt von Nordengland nach Cape Cod und zur Mitte des Atlantiks: Der Autor unternimmt nicht nur eine persönliche und biografische Reise, sondern auch eine (kultur-)historische; er erzählt seine eigene Geschichte einer Leidenschaft und liefert zugleich erhellende Antworten auf die Frage, was das Faszinosum Wal ausmacht.