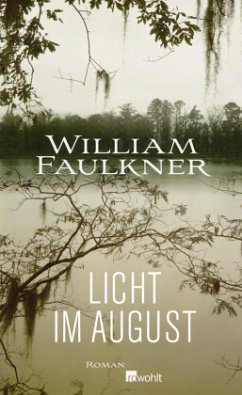Einer der größten Romane des 20. Jahrhunderts in neuer Übersetzung.
Mit sinnlicher Leidenschaft entrollt Faulkner in diesem Klassiker der Literatur des 20. Jahrhunderts drei Lebenswege in der weiten Landschaft des Mississippi: Lena Grove, eine junge Schwangere auf einer fremden Landstraße, sucht ihren Geliebten. Am Ende hat sich ihr Schicksal in der Begegnung mit einem anderen Mann erfüllt, aber das Chaos sündhafter Verstrickung entlässt sie wieder fast unberührt. Joe Christmas, ein Wanderarbeiter, der sich seiner Rassenzugehörigkeit nicht sicher ist, findet hingegen keinen anderen Ausweg aus seinem Dilemma, als selbst zum Mörder zu werden. Der Geistliche Gail Hightower durchschaut das Gewebe aus religiösem und rassischem Fanatismus, kann sich aber nicht aus seiner Verklärung der "glorreichen" Südstaatenvergangenheit befreien ...
Faulkners zwingende Modernität, sein multiperspektivischer, psychologischer Stil machten "Licht im August", 1932 geschrieben, bereits 1935 bei Rowohlt veröffentlicht, zu einem der wirkungsmächtigsten Romane des 20. Jahrhunderts - hierzulande vor allem nach dem Krieg, als er in einer rororo-Zeitungsausgabe einem breiten Publikum zugänglich wurde.
Der Rowohlt Verlag legt Faulkners besten und bekanntesten Roman in einer zeitgemäßen Neuübersetzung von Helmut Frielinghaus und Susanne Höbel vor, versehen mit einem Nachwort von Paul Ingendaay.
Mit sinnlicher Leidenschaft entrollt Faulkner in diesem Klassiker der Literatur des 20. Jahrhunderts drei Lebenswege in der weiten Landschaft des Mississippi: Lena Grove, eine junge Schwangere auf einer fremden Landstraße, sucht ihren Geliebten. Am Ende hat sich ihr Schicksal in der Begegnung mit einem anderen Mann erfüllt, aber das Chaos sündhafter Verstrickung entlässt sie wieder fast unberührt. Joe Christmas, ein Wanderarbeiter, der sich seiner Rassenzugehörigkeit nicht sicher ist, findet hingegen keinen anderen Ausweg aus seinem Dilemma, als selbst zum Mörder zu werden. Der Geistliche Gail Hightower durchschaut das Gewebe aus religiösem und rassischem Fanatismus, kann sich aber nicht aus seiner Verklärung der "glorreichen" Südstaatenvergangenheit befreien ...
Faulkners zwingende Modernität, sein multiperspektivischer, psychologischer Stil machten "Licht im August", 1932 geschrieben, bereits 1935 bei Rowohlt veröffentlicht, zu einem der wirkungsmächtigsten Romane des 20. Jahrhunderts - hierzulande vor allem nach dem Krieg, als er in einer rororo-Zeitungsausgabe einem breiten Publikum zugänglich wurde.
Der Rowohlt Verlag legt Faulkners besten und bekanntesten Roman in einer zeitgemäßen Neuübersetzung von Helmut Frielinghaus und Susanne Höbel vor, versehen mit einem Nachwort von Paul Ingendaay.

© BÜCHERmagazin, Martin Maria Schwarz (mms)

Gesellschaft im Wetterleuchten: Nach den Entwürfen eines komplizierten Gehirns entwarf William Faulkner den amerikanischen Süden. Dem Leser des nun neu übersetzten Romans "Licht im August" wird der Kopf durchgerüttelt.
Von Brigitte Kronauer
Die Auffassung, man könne das Herstellen von Literatur an einer Schule lehren oder lernen, lehnte er mit deutlichen Worten ab, und Melvilles "Moby Dick" war für ihn gerade deshalb der großartigste Roman Amerikas, weil er "über Menschenkraft ging" und deshalb nicht ganz gelingen konnte. Bei Schriftstellern, die von der formschaffenden Glut ihrer Gedanken und der Bilderflut ihres Inneren zur Entäußerung gedrängt werden, hielt er ein aufwendiges Bemühen um stilistische Eleganz für das Verschleudern kostbarer Lebenszeit. Charlotte Rittenmeier, junge Bildhauerin und tonangebende Figur des Romans "Wilde Palmen und der Strom" (1956), formuliert drastisch und ex negativo das Ziel ihrer Arbeit: "Nicht solche Dinge, die einem bloß ein bisschen die Geschmacksnerven kitzeln und hinuntergeschluckt werden und nicht einmal in den Eingeweiden hängenbleiben, sondern unverdaut den Darm verlassen und im Abzugskanal davongeschwemmt werden, solche Könnte-genausogut-Nichtgewesenseins."
Im Fall jener Charlotte gilt das Credo dann aber doch nur für die sexuelle Liebe. Ihrem Autor William Faulkner (geboren 1897, gestorben 1962, beides im Bundesstaat Mississippi), nach dem Diktum des großen Stilisten Nabokov Produzent "hinterwäldlerischer Heimatchroniken", war es tiefe künstlerische Überzeugung.
Joe, Held und Dämon des Romans "Licht im August" (1932), der die hässlichen Antriebe unter der obersten Hautschicht seiner von Gerüchten, Lügen, von religiösen und patriotischen Manien geprägten Umwelt bereits als Ungeborener erregt, besitzt alles, um sich im literarischen Stoffwechselprozess des Lesers glorreich zu behaupten. Und das nicht etwa, weil er auf den Namen "Christmas" hört und Faulkner ihn genauso alt wie Jesus werden lässt. In ihm steckt, verhängnisvollstes Kainszeichen in der damaligen Südstaatengesellschaft, ein Quentchen "Niggerblut", auch wenn es an ihm keinerlei physiognomische Hinweise gibt, niemand tatsächlich etwas Genaues weiß und belegen könnte und der Makel (Hypothese? Fiktion?) ihm selbst lediglich von klein auf eingeflüstert wird.
Für sein reales Leben bedeutet der Verdacht Ächtung von Anfang an. Daraus folgen erlittene, ausübende, schließlich tödliche Gewalt und ein Selbsthass, der so weit geht, dass Joe sich angesichts einer weißen Prostituierten, die keinen Anstoß nimmt an seinem provozierenden Geständnis, "Nigger" zu sein, eine zwei Jahre andauernde Übelkeit einhandelt und den Beischlaf mit schwarzen Frauen als Entgleisung des Weißen in sich empfindet. In Joe Christmas kulminiert, bis zur verzweifelt selbstherrlichen Raserei, das Gefühl totaler Einsamkeit, ein Zustand, der im Verlauf des Geschehens, noch über die Jagd mit Bluthunden und sein Ende in der Provinzstadt Jefferson durch Lynchmord und Kastration hinaus, ebenso bei den seinen Weg kreuzenden Personen, wenn auch verstohlener, offenbar wird.
Nur die ledige, auf der Suche nach dem Vater ihres Kindes wochenlang von Alabama nach Mississippi wandernde, hochschwangere Lena Grove, beherrschende Protagonistin der ersten und letzten Szenen des Romans, die ihrem Widerpart Christmas als Einzige nicht begegnet, ruht unberührt in sich selbst als ihrer eigenen Heimat. Sie lebt in einem beinahe erschreckenden vegetativen Seelenfrieden. Faulkner, selbst schon früh schwerer Alkoholiker, bekannte 1957 gegenüber den Studenten eines Oberseminars seine Bewunderung für Lenas allen Wettern trotzende Konstanz. Im selben Gespräch erklärte er, Christmas habe nicht gewusst, "wer er war" und wie er es "jemals in seinem Leben" herausfinden sollte. Weil ihm das unmöglich sei, habe er sich absichtlich "außerhalb der Menschheit" gestellt - eine fürchterliche, noch immer nicht aus der Mode gekommene Floskel!
Der Künstler Faulkner ist jedoch weitaus klüger als der hier befragte Faulkner. Gerade dadurch, dass der weiße "Nigger", eine ironische Konstruktion, nicht weiß, woher er kommt und wo er jemals heimatlich ausruhen kann, gehört er im existentiellen, ja metaphysischen Sinn zur dubiosesten Gruppe aller Lebewesen: zu den Menschen. Für die Zeit von Barack Obama und Heidi Klum ist Christmas keineswegs zur mittlerweile historischen Figur einer ehemaligen Rassenproblematik geworden, wobei nicht übersehen werden soll, dass gegenwärtig in Amerika jeder neunte Schwarze zwischen zwanzig und dreißig Jahren im Gefängnis sitzt. Joes beständiges Flackern greift die riesige Gemeinde derer an, die sich mit diabolisierenden Projektionen auf andere ("das Böse") entlasten und gegen ein geleugnetes besseres Wissen zu panzern versuchen: uns.
Präziser: Faulkner liefert mittels einer bestimmten Methode erdrückende Indizien dafür, dass es weder dem hochgefährlichen Joe, den er (ob Lesern das Bild heute peinlich ist oder nicht) konkret und christlich als Sündenbock verbluten lässt, noch einem anderen der flüchtig oder länger auftauchenden bürgerlichen Individuen gelingt, dem zweifelhaften Vergnügen zu entrinnen, ein - heterogener - Mensch zu sein.
Der Autor zersplittert und verströmt sich in sie alle, etwa in den verfemten Geistlichen Hightower, in Byron, die ehrliche Haut, der sich Lena gegenüber in eine Josefsrolle begibt, in die vom "Nigger" zu später Fleischeslust erweckte Miss Burden, in die bizarre, zwischen Gefügigkeit und Entschlossenheit schwankende Mrs Hines, die sich am Ende als Joes Großmutter erweist. Sie offenbaren in plötzlichen Bekenntnissturzfluten und Selbstgesprächen eine Entflammbarkeit für wahnhafte Übersteigerungen, denen Joe nur die Zündschnur liefern muss.
Faulkner schreibt jeweils aus dem Horizont, aus der perspektivischen Wahrnehmungsverfärbung eines ratlosen, leidenschaftlichen, schwankenden Inneren seiner Figuren, um dieses Innere dann abrupt mit seiner Außengestalt zu konfrontieren, mit einer noch eben von ihm durchbrochenen selbstgerechten, befremdenden Oberfläche. Sie erzeugt für die Leser, wie für die Personen des Romans untereinander, eine Fülle von Missverständnissen, ist Irreführung und Reduktion des wahreren Selbst. Und schon fällt man unvorbereitet in andere Gefühls- und Erinnerungsstrudel, wird in sie eingesogen, ohne gleich zu wissen, zu wem sie gehören. Wichtiger aber: Man ertappt sich dabei, über der frisch installierten Außenfläche der Person die Welt darunter bereits vergessen zu haben, als gäbe es sie nicht, um wenig später aus Augen und Schlund dieser Figur erneut einen Blick auf die offizielle Kontur und die nicht begreifbaren Handlungen einer anderen zu werfen, die uns eben verschlang mit ihrem Inneren und wieder ausspuckte, damit wir weiter in den nächsten Gefühlskosmos gleiten und die eben erkannte Person an die nächste mitsamt ihrer Vergangenheit verraten.
Der Autor, der seine gesamte psychische Energie kurzzeitig für die jeweilige Innenansicht einer Person einsetzt, mutet dem Leser zu, dass er sich nirgendwo im Farbenspiel von Ablehnung und Zustimmung gemütlich einrichten kann, wie er es letzten Endes in Leben und Literatur, einer übersichtlichen Gefühlsökonomie wegen, so gern möchte. Stattdessen sieht sich der lesende Konsument dem Schmerz der schroffen Form ausgesetzt! Das Gelände, auf dem er sich bewegt, ist nicht stabil, sondern ein ständig zu Schollen aufgerissener Acker. Er wird durch das permanente Hin und Her zwischen innen und außen zu einem anderen Gesamt- und Weltgefühl gedrängt, weg von fester Etablierung, von Verdammung und Idolisierung Einzelner hin zu einer Generalempfindung gegenüber der Wirklichkeit. Der von Faulkner geschätzte Joseph Conrad hatte es mit Multiperspektivität und den ins Flimmern geratenden Umrissen seiner Protagonisten vorbereitet.
"Sie schnitt wie ein Messer durch alles; war gleichzeitig außerhalb und sah zu", heißt es im 1925 erschienenen Roman "Mrs Dalloway" von Virginia Woolf. Zweifellos machte gerade dessen revolutionäre Formensprache auf Faulkner folgenreich Eindruck. Sein Werk lässt sich als Gelenkstelle zwischen den Heroen der Moderne wie Woolf und Joyce und der Wucht einer älteren, auf melodramatische Handlungen bedachten Epik lesen. Dabei steht auf der einen Seite die faktische Realität, die aber einer laufenden Erosion durch andere Kräfte ausgesetzt ist. Faulkners schleichende Zersetzung unbeweglicher Tatsachen, nicht durch Phantastik, sondern durch wuchernde Innenwelten und unzuverlässige Zeitsprünge hat, ein Beispiel für viele, unübersehbaren Einfluss auf das Werk des großen Südamerikaners Carlos Onetti ausgeübt.
Den Schriftsteller Faulkner wird dabei vor allem die Möglichkeit interessiert haben, nicht auf Saft und Kraft starker Handlungen verzichten zu müssen und doch deren Klischeeabläufe, speziell die von "Heimatchroniken", zu brechen. Die Redeströme und Innenmonologe, die er seinen Provinzlern unterstellt, sind häufig nicht psychologisch zu rechtfertigen, ihr teilweise spekulatives Denken ist unter naturalistischen Aspekten nicht akzeptierbar. Gegen das Diktat schneller Plausibilität wird etwas anderes durchgesetzt, etwas Glaubwürdigeres: die Folgerichtigkeit eines künstlerischen Systems, mit dem Faulkner die Wirklichkeit seiner Romane errichtet. Es ist die Form, die hier Helligkeit in die Finsternisse ziemlich widerwärtiger, anständiger, im Handumdrehen mörderischer Kleinstadtgesellschaften bringt.
Wenn das verführte Landmädchen Lena mit dem letzten Satz des Romans nur leicht verändert den des Anfangs zitiert: "Da sind wir erst vor zwei Monaten von Alabama gekommen, und jetzt ist das schon Tennessee", dann resümiert sie in der ihr eigenen schönen Einfalt ein stürmisches Geschehen sub specie aeternitatis. Dem Leser aber ist in diesen acht Wochen von Lenas Wanderweg der Kopf gerüttelt und umgeordnet worden, und das nicht nur zwischen den Wechseln von Nahaufnahme und Vogelperspektive, von konventioneller Außenansicht und seelischer Eruption.
In zeitlichen Schlingen, Schleifen, Bögen, in spannungssteigernden Vor- und Rückgriffen, in taktisch vorenthaltenen Informationen, die irgendwann punktgenau dort nachgeliefert werden, wo sie ins bisher rätselhafte Bild passen und Lücken im Gang der Ereignisse schließen, hat der Autor eine gewaltige Landschaft erstellt. Es ist, zweifellos, Faulkners alte Heimatlandschaft Mississippi, deren reale Ingredienzien, Licht, Geruch, Geologie, Historie, Armut, Arbeit, Politik, Fanatismus und Krieg, die der Melville-Verehrer jedoch nach den Entwürfen eines komplizierten Gehirns des zwanzigsten Jahrhunderts zu einem vieldimensionalen Block umgestaltet. Ein Gehirn, nebenbei, das keineswegs auf die Gerissenheit filmischer Effekte und Cliffhanger verzichtet.
Der Roman ist jetzt nach der Erstübersetzung durch Franz Fein (1935) von Helmut Frielinghaus und Susanne Höbel neu übersetzt worden. Seine Sprache klingt jetzt frischer, von deplaziert Gravitätischem befreit. Fein: "Dann pflegte sie in dem engumschließenden, atmenden Halbdunkel ohne Wände zügellos zu sein, ihr Haar war wild ..., ihre Hände waren wild, und ihr Atem hauchte: ,Neger! Neger! Neger!'" Neu übersetzt heißt es: "Dann gebärdete sie sich wild, im engen, atmenden Halbdunkel ohne Wände, das wilde Haar in Strähnen ..., mit ihren wilden Händen und ihrem Keuchen: ,Neger! Neger! Neger!'" Da sind auf kleinem Raum gleich zwei, drei wesentliche Verbesserungen zu konstatieren.
"Licht im August" gilt zu Recht als einer der wirkungsmächtigen Ecksteine der amerikanischen Moderne, und das aus mancherlei Gründen. Der denkwürdigste und bewegendste scheint mir inzwischen seine Überwindung der unendlichen Entfernungen zwischen den menschlichen Außenflächen zu sein, Distanzen, die das Werk ohne Erbarmen verdeutlicht. Zugleich aber erbittet und erzwingt es, und zwar auf formaler, deshalb nachhaltiger, nämlich grundsätzlicher Ebene, durch seine Stürze ins Innere der Figuren Mitgefühl mit all seinen beschränkten, verdorbenen, unglücklichen, einander partiell feindlichen Geschöpfen. Das ist sein Wunder und sein Appell: tief beunruhigendes Mitgefühl für alle, ohne Ausnahme.
- William Faulkner: "Licht im August". Roman. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Helmut Frielinghaus und Susanne Höbel. Rowohlt Verlag, Reinbek 2008. 480 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Rasse, Geschlecht, Religion: Diese Zutaten aus William Faulkners wüstem und unbehauenen Südstaatenroman, der 1935 erstmals in Deutschland erschien, sind inzwischen von der Bildfläche anthropologischer Kategorien verschwunden. Dennoch findet es Michael Rutschky bemerkenswert, wie wenig dieses Manko an Aktualität den Roman über den Waisen und Mörder Joe Christmas tangiert. Der Grund dafür liege im epischen Material, das "sich selbst zu generieren" scheint, so der Rezensent. Eine ähnliche Umwertung erfahren die von Faulkner verwendeten Kunstgriffe. War es damals noch der innere Monolog als Ausdruck avantgardistischer Schreibtechnik, verschiebt sich der Fokus heute auf die Polyphonie der Perspektiven, "das Geflecht der Personen und Begebenheiten, das Joe Christmas enthält und vernichtet". Dem kritischen Leser verspricht Rutschky einen Lektüregenuss und an der neuen Übersetzung hat er so gut wie gar nichts auszusetzen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH