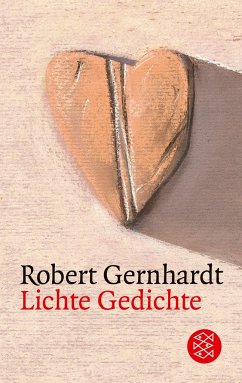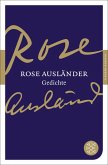Lichte Gedichte widmet sich in neun Abteilungen den ewigen Themen aller Dichtung ebenso wie sehr zeitgenössischen, ja privaten Sujets. Von der Liebe, der Person, der Natur und der Kunst ist anfangs die Rede, mit Tod und Erkrankung schließt die Sammlung, wobei "Herz in Not", das "Tagebuch eines Eingriffs in einhundert Eintragungen", wider Erwarten für ein gutes Ende und dafür sorgt, daß das Versprechen "licht" nicht zu einem schlichten "lich" verkümmert. Der für Gernhardt typische Spagat zwischen ungenierter Komik und dezidierter Ernsthaftigkeit hat in seinen Gedichten eine neue Qualität erreicht: Der dunkle Grund der Erdenschwere kommt ständig zur Sprache und verwandelt sich ebenso beständig vor unser aller Augen in Helligkeit und Schnelligkeit.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Robert Gernhardts neue Gedichte · Von Thomas Steinfeld
Langsam ändert sich der Ton. "Lichte Gedichte" ist Robert Gernhardts dritter Lyrikband - nach "Körper in Cafés" von 1987 und "Weiche Ziele" von 1994 -, und das Langgedicht "Herz in Not" bildet allein den letzten, mit "herzlich" überschriebenen Teil des Buches. Die Sprache ist sofort als die seine zu erkennen. Die rhythmischen Übertreibungen, die kompakten Vokale, die ironischen Bilder, die Parodien und die Pointen, die am Ende eines Gedichts die Botschaft in die Weite des Alls schießen, sind alle noch da. Aber "Herz in Not" muß fast ohne Reime auskommen, und an ihrer Statt wehen die schwarzen Fahnen von Alter und Tod: "Es quillen auch Tränen. / Die Anlässe: fließend. / Ein Foto von Wolf, / ein Erinnern der Toten / ein Druck jener Hand, / die das Wasser in den Vasen / wechselt und meine Hand festhält." Das ist schon sehr privat, ja fast indiskret. Das Gedicht rührt hier an etwas, was sich mit Ironie sehr schlecht verträgt: Es will Betroffenheit.
Nicht in allen Strophen dieses Epos geht die Entblößung so weit, es gibt scherzhafte, satirische, auch böse. Und doch zieht es Robert Gernhardt immer wieder an diese Grenze. "Herz in Not" ist ein Memento mori, aber der Dichter zitiert nicht die barocke Lyrik, sondern er erfindet sie neu. "Er hört dem beleibten Arzt zu", "Er beschwichtigt sich" oder "Er wünscht sich einen Fotografen herbei" heißen die Gedichte. Die Formel ist bekannt. Der Barock ließ seine Helden gerne in der dritten Person auftreten, vom Dichter sollte nicht die Rede sein, er hatte das Allgemeine in der Fiktion zu suchen. Bei Robert Gernhardt ist es jetzt umgekehrt. Er legt Zeugnis ab, er sucht in der Fiktion das einzelne, und ironisch ist nur die Geste, mit der er sich beim Beobachten selbst beobachtet. Denn die Versuche, das Interesse des Lesers auf die poetische Form zu lenken, sind darauf angelegt, durchschaut zu werden. Man sieht, um im Bild zu bleiben, das Herz des Dichters unter seinem Kostüm pochen.
Neun Teile hat der Band "Lichte Gedichte", sie sind mit Stimmungslagen von "lieblich" über "alltäglich" bis "herzlich" überschrieben, und "Herz in Not" ist nur das letzte Stück. Da gibt es das wunderbare, komische "Couplet von der Erblast", in dem "spätantike Männerkreise" von "postmodernen Frauengruppen" zur Rechenschaft gezogen werden. Da ist die kleine Moritat vom mexikanischen Torwart und ein Lied über den Vogel, der die Luft "durchschifft", aber sich freuen darf, kein Fisch zu sein. Viele dieser Gedichte enden mit einem Lachen. Aber man lacht nicht, weil eine unangemessene, eine überhebliche Vorstellung zuschanden geht. Für eine Entlarvung ist das Lachen zu klein. Eher wirkt die Pointe, als lasse der Dichter sein Gedicht fallen, als habe er nur einmal kurz an etwas Größeres, Erhabeneres rühren wollen, und dann ist ihm die prosaische Einsicht dazwischengefahren.
"Alles über den Künstler" heißt ein in diesem Sinne typisches Gedicht: "Der Künstler geht auf dünnem Eis. / Erschafft er Kunst? Baut er nur Scheiß? / Der Künstler läuft auf dunkler Bahn. / Trägt sie zum Ruhm? Führt sie zum Wahn? / Der Künstler fällt in freiem Fall. / Als Stein ins Nichts? Als Stern ins All?" Die Reihenfolge der drei Strophen ließe sich umdrehen. Dann stünde das Wörtchen aus der Umgangssprache am Ende. Und das wäre eine richtige Gernhardt-Pointe, weil sie den Kreis des Poetischen durchschlägt, und dann wären die sechs Verse noch wehmütiger, als sie es ohnehin schon sind. Aber dann wäre auch ganz offensichtlich, daß die Pointe weniger lustig als tragisch ist. Man hätte auch "Vanitas" über das Gedicht schreiben können.
Gottfried Benn nahm große Mühen auf sich, um den neuen Reim zu finden. Gernhardt ist bereit, auch den nächstliegenden zu nehmen. Das erinnert manchmal an die Kühnheit der Provinz und mag komisch wirken, weil der geschulte Leser dieses Repertoire der Dichtkunst für vergangen hält. Aber der Dichter ist so gelehrt und so klug, daß er den Einwand immer schon mitgedacht hat. Die erprobten Mittel der Dichtung sind ja nicht aufgegeben worden, weil sie ihren Dienst versagten. Dieses Vertrauen in die Einprägsamkeit der Versmaße, in die Stimmung der Vokale und in die Suggestion des Reims wirkt aber so keck, weil die poetischen Techniken heute nur noch in der Satire und in der Werbung gebraucht werden.
In der Lyrik sind Rhythmus, Melodie und Klang dem längst konventionell gewordenen Zweifel an der Sprache unterworfen. Drei Generationen moderner Dichter wurden nicht müde, auf geheimnisvolle Weise sagen zu wollen, was sich doch nicht sagen läßt. Gernhardt dagegen macht sich zum Komplizen des Lesers. Was ihn mit dem Leser verbindet, ist die ganz und gar unpoetische Überzeugung, daß man sich verstehen kann. "Der heiße Tag", dichtet Robert Gernhardt, "das Summen wilder Bienen / geht in dem Wein so emsig ein und aus, / als wolle jede mit dem Hinweis dienen: / Wer jetzt ein Haus hat, gehe in dies Haus." Das ist natürlich eine Parodie auf Rilke. Aber sie will nicht spotten. Es ist Bewunderung darin, aber mehr noch inszeniertes Ungeschick. Denn warum ist der letzte Vers so schwach? Weil die Sehnsucht nach der Transzendenz so ungemütlich ist.
Und so kann es auch keinen Gegenstand mehr geben, der sich dem Dichten entzieht. Das Bungee-Seil, das Kernkraftwerk, das Toilettenpapier - die Leichtigkeit, mit der das Einverständnis gelingen soll, entspricht dem Übermut im Umgang mit dem Repertoire. So entsteht der Eindruck, Gernhardt gehe weit hinter die Romantik zurück und fange dort wieder an, wo das Dichten ohne jeden Tief- und Hintersinn war. Ganz offenbar ist das in den Gedichten unter dem Zwischentitel "beweglich". Sie handeln von lauter Reisen, die ein sehr verläßliches Bild von einer beinahe völlig befriedeten, aber in kleinen Mustern ruhelos bewegten Bundesrepublik zeichnen.
Der Dichter betrachtet begehrlich zwei Freundinnen im Zug zwischen Karlsruhe und Kehl, aber sie sehen ihn nicht. Er fährt nach Büdingen, um sich vom plötzlichen Erscheinen der Stadt, und nach Groß-Gerau, um sich von der erwartbaren Bescheidenheit der Verhältnisse überraschen zu lassen. Vor allem aber fährt er an Günzburg vorbei, wo der Zug nicht hält, obwohl die Türme grüßen. Und das muß so sein: "Daß uns etwas ergreift, / meint auch, daß wir es nicht fassen. / Was den Schluß nahelegt, / Günzburg links liegen zu lassen. / Und nicht nur Günzburg." Ein solches Gedicht ist auf schlichte Weise wahr, es ist ein Sinngedicht. Aber die Weisheit, daß man Ideale besser Ideale bleiben läßt, hat etwas Aufdringliches, fast Banales. Darauf hat es Gernhardt indessen auch angelegt. Denn sonst hätte er die für das Verständnis des Gedichts gar nicht mehr nötige letzte Zeile nicht freigestellt. So hängt sie in der Luft und ist pädagogischer Imperativ und absurde Kehre zugleich.
"Überredung und Unterricht, auch Ergötzung der Leute", erklärte der Dichter Martin Opitz vor dreihundert Jahren, sei der vornehmste Zweck der Poesie. Dem Barock hat diese Überzeugung den nachhaltigen Ruf eingetragen, seine Werke nach dem Musterbuch komponiert zu haben. Heute hält man das Klischee gern für eine Redensart, für eine leere, abgelegte Floskel, und im Zweifelsfall gar für eine Lüge. Aber der kritische Geist tut dem Klischee Unrecht. Denn wo ein solches Klischee ist, ist Verständigung schon einmal gelungen. Man kann sie abrufen wie eine gemeinsame Erinnerung. Solche Gemeinplätze kultiviert der Lyriker Robert Gernhardt. Zwar ist auch er ein zeitgemäßer Dichter, und das heißt, daß er die Klischees noch einmal künstlich machen muß, das geöffnete Herz, die Sanduhr, den Ritter, den Tod und den Teufel. Aber das heißt auch, daß hier ein Prinzip der Moderne aufgegeben ist. Der Leser muß dem Gedicht nicht mehr gerecht werden. Er kann etwas erwarten.
Es gibt schwache Poeme in diesem Band, und nicht immer kann der Leser erraten, was es mit solcher Schwäche auf sich hat. "Was ihn beschäftigt / was ihn bewegt / er in seine Worte legt / Der Dichter." Aber zu Gernhardt gehört auch, daß man ihm einen Mangel sofort verzeiht. Und das liegt nicht daran, daß hinter dem Gedicht ein freundlicher Mensch erkennbar ist. Hier ist es vielmehr mit literarischen Urteilen allein nicht getan. Gernhardt ist ein Pionier, auch und gerade weil ihm so viele vorangegangen sind. Er erinnert sich, um wieder von vorne anzufangen. Er will, daß etwas bleibt.
Robert Gernhardt: "Lichte Gedichte". Haffmans Verlag, Zürich 1997. 264 S., geb., 36,-DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main