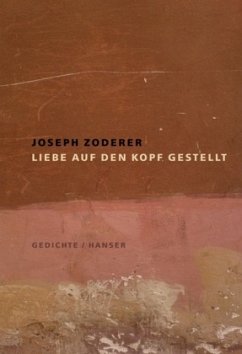Beatrice von Matt feiert Joseph Zoderer in der Neuen Zürcher Zeitung als einen großen europäischen Schriftsteller: "Dass Zoderer den Konflikt von Entfremdung auch in Beziehungen zwischen Männern und Frauen aufdeckt, leuchtet ein. Nirgends wirken sich Heimat und Ausgesperrtsein deutlicher aus als im Umfeld der Liebe. "Mit Liebe auf den Kopf gestellt legt der Erzähler Zoderer zum ersten Mal seit Jahrzehnten einen Gedichtband vor. Und zwar einen, der sich wiederum mit den großen Themen seines Werks beschäftigt: Liebe und Verzweiflung, Fremdheit und Vertrautheit, Abschied und Wiederkehr:"Zeig mir / Wolfsherz / die Fährte / zum dunkelsten Ort, zum / Niegefundenen ..."

Joseph Zoderer stellt die Liebe poetisch auf den Kopf
Die Grenze zwischen dem Ich und dem Anderen ist undurchlässig. Dennoch streben Menschen, vor allem in der Liebe, nach Vereinigung; wir wollen eins werden, obwohl da doch immer und ausschließlich zwei bleiben. In der Poesie hingegen ist alles möglich. Nicht umsonst schreibt man dem Dichter eine besondere Aufnahmefähigkeit für eigentlich äußerlich bleibende Phänomene zu. Dabei geht es oft um beinahe esoterisch aufgeladene Seherfähigkeiten, um einen lidlosen Blick, um eine Klarsicht, die auch Dinge zusammenschauen und benennen kann, die der flüchtigen Anschauung entgehen - die Basis aller Metaphorik.
Joseph Zoderer, 1935 in Meran geboren und in Graz aufgewachsen, scheint geradezu prädestiniert für jene Art der Durchlässigkeit, die einem feinen Sensorium eignet. Als deutschsprachiger Autor mit österreichischer kultureller Prägung, der einen italienischen Pass besitzt, weiß er seit jeher von Fremdheit und Vertrautheit in einem zunächst wörtlichen Sinne zu erzählen. So kritisierte sein bislang bekanntester Roman "Die Walsche" von 1982 die streng bewachten Grenzen zwischen italienischer und deutscher Kultur und wurde überraschend in italienischer Übersetzung zum Bestseller.
Doch Fremdheit und Vertrautheit, Ausgrenzung und Integration gibt es in vielerlei Hinsicht, wie Zoderer in seinem neuen Gedichtband "Liebe auf den Kopf gestellt" eindrucksvoll belegt. Der gemeinhin als Romancier geachtete Schriftsteller veröffentlichte zwar bereits Ende der fünfziger Jahre erste lyrische Texte, denen unter anderem Dialektgedichte und, 1979, die "Pappendeckelgedichte" folgten, die von einer kompletten Entfremdung des lyrischen Ichs kündeten. Seitdem jedoch widmete er sich vorwiegend der Prosa. Umso erstaunlicher ist es daher, wie mühelos sich nun einzelne Bilder schichten, ohne an Komplexität und Anschaulichkeit zu verlieren.
Oberflächlich betrachtet schildert da jemand sich selbst und seine Umgebung, vor allem die Erscheinungen der Natur. Selten liest man heutzutage, da allerorten von Urbanismus und industriellen Agglomerationszonen die Rede ist, in dieser großen Selbstverständlichkeit von derart vielen Bäumen, Blumen und Vögeln: Eichel- und Tannenhäher, Krähen, die "immer gleiche graue Taube", Amseln, Sperlinge, Meisen, Kormorane und Grasmücken bevölkern die zuerst spröde wirkenden, nahezu interpunktionslosen Verse, die rhythmisch vor allem durch Schrägstriche strukturiert werden.
Gleichwohl zeichnen sie kein hinterwäldlerisches, privates Idyll, denn "die Schatten toter Tiere" liegen immer noch auf der Asphaltstraße, wo eine Frau hofft, "ausgetrunkene Bierdosen / und ausgeleckte Pizzapappkartons" zu finden. Und selbst die düstere Weltlage ("irakische Massaker") hallt in den Nachrichten wider, um Stadt- und Cafébesuche, Spaziergänge, Zugreisen oder einen "mit einem Sonnenspiel durch die Tür" tretenden Morgen zu trüben: "Verschwommen lese ich eine Titelzeile ,Bush und Blair: Der Krieg war rechtens' / Ich schütte Zucker in den Mokka / das würzt die Kraft der Diabetes / Und außerdem liebe ich das Bittere / Ich brüte Mordgedanken / dazwischen liegt der Atlantik." Von agitatorischem Furor ist Zoderer, der sich einst für die Apo in Wien engagierte, dennoch weit entfernt, weil, wie resignativ festgestellt wird, "weit und breit auch kein feindliches Gesicht" zu erkennen ist. Stattdessen, "aus der Haft der politischen Reden / entlassen", betrachtet er aufmerksam Innen- und Außenwelt, um sie im poetischen Liebesspiel, das nicht frei ist von Widerständen, Kummer und Verzweiflung, miteinander zu verbinden.
Die scharfsinnigen Beobachtungen der Natur finden ihr Echo schließlich über mehrere allesamt unbetitelte Gedichte hinweg im eigenen Körper, in der individuellen Gedankenwelt oder in der Beziehung zu einem geliebten Gegenüber, zur Frau, zur Tochter; das reicht vom recht konventionellen "Fliederduft in deinen Haaren" über "Sommerhaut" und "Winterlügen" bis zum "von Blütenstaub" klebenden Atem. Beiläufig, leidlich schmucklos, klassischer Versformen abhold und in häufig hypotaktischem Stil wird dem vermeintlich Profanen auf diese Weise Bedeutung verliehen - oder diese Bedeutung wird im Alltäglichen überhaupt erstmals jäh erkannt und benannt.
Auch wenn Zoderers zuweilen surreale Gedichte nicht in thematisch geordneten Zyklen angeordnet sind, folgen sie einer subtilen Dramaturgie, gebildet aus Motiven des Gegensätzlichen: Erinnerung und Vergessen, Verlust und Wiederkehr, Zweifel und Gewissheit, Trauer und Glück, Nähe und Ferne. Dies alles wird faszinierend unscheinbar und sinnlich miteinander verknüpft mit einer Gelassenheit, die sich deutlich von aufgesetzter Souveränität oder künstlichem Zynismus - beide werden in der zeitgenössischen Lyrikrezeption allzu oft mit Lakonie und Sarkasmus verwechselt - unterscheidet. Hier wird kein überhebliches Bescheidwissen, keine gottgleiche Perspektive suggeriert; sich selbst und allem anderen begegnet das lyrische Ich Zoderers stets auf gleicher Augenhöhe. Es lohnt sich also, genau hinzuschauen; dies gilt für den Dichter wie für seine Leser gleichermaßen, denn auch der Akt des Lesens verlangt nach einer speziellen Aufnahmefähigkeit und Durchlässigkeit, um, so widersprüchlich das ist, durch die Augen eines anderen zu sehen.
ALEXANDER MÜLLER
Joseph Zoderer: "Liebe auf den Kopf gestellt". Gedichte. Hanser Verlag, München 2007. 112 S., geb., 14,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Beeindruckt ist Alexander Müller von Joseph Zoderers Gedichten, die um Themen wie Fremdheit und Vertrautheit, Ausgrenzung und Integration kreisen. Er bescheinigt dem Autor eine feine Wahrnehmung, präzise Beobachtungen und echte Gelassenheit. Genaue Naturbeschreibungen, die keinesfalls ein falsches Idyll zeichnen, sondern die finstere Weltlage (Irakkrieg) einfließen lassen, korrespondieren in Müllers Augen mit Gedichten über die Gedankenwelt des lyrischen Ichs und dessen Beziehungen zu einem geliebten Gegenüber. Er hebt hervor, dass die Gedichte einer "subtilen Dramaturgie" aus gegensätzlichen Motiven wie Erinnerung und Vergessen, Verlust und Wiederkehr, Zweifel und Gewissheit, Trauer und Glück usw. folgen, die Zoderer "faszinierend unscheinbar" und "sinnlich" miteinander verbinde.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH