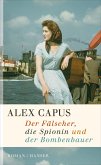"Wie deine Lippen schmecken. Und was du mir zu sagen hast. 'Du fehlst mir. Immer.' Und dass du das nicht immer sagst."
Erklär mir Liebe! Michael Lentz erzählt in diesem Buch die Geschichte einer Trennung, einer neuen Liebe und einer winterlichen Reise durch Deutschland, das ein Land im Abschwung ist oder gilt das nur für den mit seiner Liebe verzweifelt Kämpfenden? Grenzüberschreitend offen und unerschrocken ungerecht, so laut, dass die leisen Töne wieder hörbar werden, erklärt Michael Lentz seine Liebe und geht aufs Ganze.
Diese »Liebeserklärung« ist ein unerhörtes, zudringliches, schamloses, hasserfülltes, zärtliches Buch, eine kompromisslose Erzählung und eine Zumutung in einem so bisher nicht gehörten emotionalen und erotischen Ton. Diese Liebeserklärung vergisst man nicht.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Erklär mir Liebe! Michael Lentz erzählt in diesem Buch die Geschichte einer Trennung, einer neuen Liebe und einer winterlichen Reise durch Deutschland, das ein Land im Abschwung ist oder gilt das nur für den mit seiner Liebe verzweifelt Kämpfenden? Grenzüberschreitend offen und unerschrocken ungerecht, so laut, dass die leisen Töne wieder hörbar werden, erklärt Michael Lentz seine Liebe und geht aufs Ganze.
Diese »Liebeserklärung« ist ein unerhörtes, zudringliches, schamloses, hasserfülltes, zärtliches Buch, eine kompromisslose Erzählung und eine Zumutung in einem so bisher nicht gehörten emotionalen und erotischen Ton. Diese Liebeserklärung vergisst man nicht.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Wir haben eine Sprache der Liebe, auch wenn sie nicht immer lieb ist: In seinem ersten Roman entwirft Michael Lentz ein Kursbuch der Gefühle und stellt die Weichen neu
Bitte einsteigen. Türen schließen. Lassen Sie Ihr Herz nicht unbeaufsichtigt. Der nächste Halt ist die Endstation einer exzessiven Liebe und der Anfang einer unerhörten Liebesgeschichte. - Ein Zug fährt ab. Wohin er fährt, ist nebensächlich; Deutschland, hin und zurück, kreuz und quer. Er wird an fast jedem deutschen Bahnhof halten. Zum Aussteigen sollte sich dennoch niemand verleiten lassen, denn auf dieser Reise verheißt ein Halt noch lange keine Ankunft.
Den Hafen der Ehe hat der namenlose Ich-Erzähler von Michael Lentz' Roman bereits zu Beginn hinter sich gelassen: "Ich wache eines Tages auf und denke, meine Ehe ist zu Ende." Doch damit nicht genug: "Das Ende der Ehe ist eine andere. Bist du." Die Ehefrau nennt er "Z", die verstörende Geliebte "A"; daß es sich um Gegenpole handelt, ist ohnehin klar. Zwischen ihnen liegt ein Land, ein Dreivierteljahr und eine große Erschütterung. Von dieser Erschütterung, diesem Dreivierteljahr und diesem Land erzählt Lentz, und er tut dies mit einer schroffen, zarten und zudringlichen Unbedingtheit, die in der deutschen Gegenwartsliteratur ihresgleichen sucht.
"Liebeserklärung" ist der erste Roman des Bachmann-Preisträgers von 2001, der bisher mit den Erzählungen "Oder" und "Muttersterben" sowie mit zwei Gedichtbänden aufgefallen ist. "Liebeserklärung" ist der kompromißlose Bericht einer Beziehung und ihres Scheiterns, die Bestandsaufnahme eines Lands im Wartezustand, eine Feier des Sex und ein Feuerwerk der poetischen Sprache, verpackt in einem Monolog, einem alles mit sich reißenden Bewußtseinsstrom - fast möchte man sagen: einem Anfall. Mal Geständnis, mal Beichte, mal Gefühlsausbruch, hat Lentz Bruchstücke aus der Liebeskultur gefiltert und in eine neue, zeitgemäße Form gebracht.
Seine Wucht verdankt dieses "Planspiel einer völlig entglittenen Entzweitheit" weniger der eigentlichen Liebesgeschichte als vielmehr Lentz' Sprache. Der Neununddreißigjährige schreibt Sätze, so unmittelbar einleuchtend, daß man manche zweimal lesen muß, um sie in ihrer ganzen Ungeheuerlichkeit zu begreifen: "Es ist da eine Moräne im Gang, eine Verschleppung, Aufschiebung, wir geraten in Rückstand, der nicht einzuholende Vorentwurf, daß wir uns begegnet sind mit den Worten, es wird soundso, es wird mit uns soundso, und da haben wir uns nicht eingefunden, da haben wir nicht hineingepaßt, das schon war die doppelte Spaltung, die ins Leere geworfene Projektion." Die Zuversicht, jene leidenschaftlichen Zukunftsvisionen, die Liebende brauchen, sind diesen beiden früh abhanden gekommen.
Diese Liebe ist ein einziges Unterwegssein, eine geistige und körperliche Reise auf die Geliebte zu, ein Teufelskreis aus Sich-Losreißen, Abkehr und zweifelnder, verzweifelter Rückkehr - bis zum endgültigen Bruch. Daß es darauf hinausläuft, teilt uns der Erzähler sofort mit: "Das ist unsere Geschichte. So weit. Da bist du, und da bin ich. Und wir sind beide noch da. Das ist mehr als erwartet. Wir sind da. Wir sind anderswo. Das ist wenig genug." Es ist weniger die persönliche Niederlage, die ihm zu schaffen macht, als die Erkenntnis, daß Verstand und Gefühl gelegentlich vor ihrer gegenseitigen Unvereinbarkeit kapitulieren müssen. Zunehmend erscheint ihm jede Fahrt zu A als Reise "in eine aussichtslose Richtung". Aber was will man tun, wenn es einen so erwischt hat: "Das war keine einfache Begegnung, das war, Entschuldigung, der Urknall." Sein Leidensweg führt den Erzähler durch das triste, das "dahingestellte, zusammengebaute" Deutschland des Winters 2002. Und auch die Beziehung trägt alle Insignien der Jetztzeit: Kontrollanrufe per Handy, Liebesbeweise per SMS.
Nun wäre Michael Lentz kein Schriftsteller, Musiker und Lautpoet von Format, wenn er in seine scheinbar mühelos heruntergeschriebene "Liebeserklärung" nicht zahlreiche, mehr oder minder deutliche Verweise auf Hausgötter und dialektische Referenzgrößen eingewoben hätte. Seine Sprache vibriert nur so von Rolf Dieter Brinkmann, ein aggressiver, absichtsvoll hingeschluderter Tonfall; eine unaufhörliche, doch keineswegs unkontrollierte Folge von Bildern, Sinneseindrücken und Gedanken; unendliche, seitenlange Sätze, in denen jedes Wort sich dennoch geradezu an seinen Platz kuschelt, sicher gesetzt wie die Noten einer gelungenen Komposition. Und je länger, weiter und öfter der Erzähler im Zug reist und aus dem Fenster "deutschfern" schaut, desto mehr nimmt auch seine Sprache Fahrt auf, findet zu einem eigenen Schienen-Rhythmus, während die Handlung mitläuft, einzelne Augenblicke festhaltend, an anderen vorbeirasend, sich selbst gelegentlich kreuzend wie Bahngleise.
Changierend zwischen Liebesbrief und Haßtirade, ist der Roman auch eine Auseinandersetzung mit Søren Kierkegaard und dessen berühmtem Versuch in experimentierender Psychologie, "Die Wiederholung". Doch wie diese "Liebeserklärung" kein Antrag sein will, sondern im eigentlichen Wortsinn eine Liebe zu erklären versucht, bedeutet auch "Wiederholung" bei Lentz kein schlichtes da capo, sondern das Wiedergeholte, das Zurückholen einer Liebe aus der Erinnerung in die Literatur.
In Gestalt jener kumpelhaften Gesellen, die uns als "Rolf Dieter" (Brinkmann), "Sigmund" (Freud), "Valsher" (ein Pseudonym des Lautpoeten Valeri Scherstjanoi), "Klingstedt" (alias Heinrich von Kleist) oder eben als "der alte Däne" (Kierkegaard) vorgestellt werden, mag mancher eine unziemliche Anbiederung wittern. Doch Lentz' Zwiegespräche finden immer auf Augenhöhe statt. Das gilt auch für Herbert Grönemeyer, dessen Album "Mensch" im letzten Winter die tröstliche Hintergrundmusik, quasi den Soundtrack zur Deutschlandkrise lieferte. Fetzenweise halten Liedtexte Einzug in den Roman, und Lentz bringt es fertig, sie nie kitschig klingen zu lassen, im Gegenteil: ",Ich fühle mich unbewohnt', und ob das eine gute Zeile ist, ,in mir sind alle Zimmer frei', und ob das eine gute Zeile ist, die einer da singt."Lentz nimmt Grönemeyer ernst, wie er auch Celan oder Barthes ernst nimmt, wie er die in Gedanken immerzu umkreiste Frau ernst nimmt und sich selbst. Die Schilderung dieser Liebesentäußerung wäre irgendwann schier unerträglich, würde der Erzähler nicht immer wieder abschweifen, über das "selbst ernannte Schlußlicht" Deutschland, das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig oder seine Jugend nachdenken - ebenfalls keine leichtgewichtigen Themen, die in seiner Art, sie beiläufig abzufertigen, doch als Auflockerungen wirken.
Die vielbeschworene Ironie, die literarisch einige Zeit gern in Form angestrengter Understatements und übertriebener Oberflächenreizbarkeit daherkam, hat bei Lentz nichts verloren. Er meint es ernst. Er erzählt von einem Mann und einer Frau, die sich unbedingt "haben", zusammen "außer sich" sein wollen - doch aus der Ekstase wird rasch ein Zweikampf, der, wie sollte es anders sein, mit Worten ausgefochten wird. Kippmomente, Vermeidungsstrategien, Kommunikationsstörungen: "die Mängelliste ist groß, fast ein Totalschaden der Liebe". Distanz stellt sich ein, selbst in Momenten größter körperlicher Nähe: "Wir verstehen uns, wie das geht, wie man sich auf höchster Ebene gegenseitig einen runterholt." Und dennoch: Ist nicht auch Sehnsucht ein Liebesbeweis?
Wenn Lentz den Verlauf dieser traumatischen Beziehung schildert, klingt das gelegentlich wie ein Live-Mitschnitt, dann wieder deutlich aus dem Nachhinein erzählt, unheilvolle Konsequenzen gleich mitliefernd. Dieser Monolog ist subjektiv, ungerecht, total egozentrisch - und gerade darum überzeugend. A, die Andere, die Eine, lernen wir konsequenterweise nur durch den Erzähler kennen, und so bleibt sie fern, so verschwommen und geheimnisvoll, wie er sie empfindet. Trotzdem erscheint sie als die Stärkere in der Beziehung, als Unabhängigere. Sie ist es auch, die letztlich Schluß macht. Er tröstet sich: "Unsere Schnittmenge ist vielleicht nur guter Sex." Möbel, Freunde, Wohnungen, Städte - all das "paßt nicht". Am schlimmsten aber ist die "mentale Differenz", die nur die Körper überbrücken können.
Daß dieser Beziehung von Anfang an ein gegenseitiger Vampirismus innewohnt, wird rasch offenbar. Wie der Autor ist auch der Erzähler ein Schriftverarbeiter: "Wenn der Caran d'Ache zu Ende ist, ist die Geschichte zu Ende." In schlimmsten Momenten rettet ihn das Wissen, daß sich gescheiterte Experimente, schiefgegangene Erlebnisse mit Glück und Begabung in Literatur verwandeln lassen: "Du bist mit einem Mal ein Bleistift, der mir die Worte führt, ich führe dich übers Papier." Das Schreiben erscheint als die vielleicht einzige Möglichkeit, sich je zu "haben": indem man den anderen vereinnahmt, ihn sich zugänglich, lesbar macht. Während er ihr das "angelesene Frausein" noch zum Vorwurf macht, ist ihm das "sogenannte Mannsein" ohnehin längst und eingestandenermaßen abhanden gekommen.
Im Sinne Kierkegaards konfrontiert erst der Mut zur Wiederholung uns mit uns selbst. Denn nur in der Erinnerung und im Hinblick auf die Zukunft ist unser Selbstbildnis intakt, sind wir die, die wir sein wollen. Die Gegenwart verwehrt uns dieses gnädige Spiegelbild fortwährend. Nur manchmal, in seltenen, kostbaren Augenblicken, sind wir ganz bei uns: in jenen Momenten, da man etwas liest und versteht, eine Einheit spürt zwischen der geschriebenen Sprache, der Welt und dem Selbst. Allein Kunst - und, ganz selten, ein Gespräch - kann diese Erkenntnis bewirken. Wegen solcher Momente lieben wir, ihretwegen lesen wir - auch und gerade weil es keine Garantie für sie gibt, weil sie sich nicht erzwingen lassen. Worte schauen uns an, und durch sie sehen wir einen Moment lang besser, deutlicher, strahlender. Weil etwas so sinnfällig, schön und wahrhaftig zum Ausdruck gebracht wird, daß alle Distanz für kurze Zeit aufgehoben scheint.
Bücher, die solche Augenblicke ermöglichen, sind selten. "Liebeserklärung" ist so ein Buch, das Protokoll einer ganz persönlichen und doch jedem verständlichen Suche nach einer Sprache der Liebe. Die entscheidenden Sätze des Romans sind seine letzten: "Jetzt haben wir uns nicht mehr. Aber wir haben diese Geschichte." Indem Michael Lentz eine Liebe bannt, die im Moment ihrer Entstehung schon im Vergehen begriffen ist, indem er ihre Endlichkeit eingesteht, bewahrt er sie für alle Zeit.
Michael Lentz: "Liebeserklärung". Roman. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2003. 189 S., geb., 16,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Von einer "unerhörten Liebesgeschichte" spricht Rezensentin Felicitas von Lovenberg. An deren Erzählung begeisterte sie besonders die schroffe, zarte und zudringliche Unbedingtheit, die ihrer Ansicht nach in der deutschen Gegenwartsliteratur ihresgleichen sucht. Den Informationen der Rezensentin zufolge handelt es sich bei diesem ersten Roman des Bachmannpreisträgers von 2001 um den ungeschönten Bericht über eine Beziehung und ihr Scheitern. In diesem "alles mit sich reißenden Bewusstseinsstrom" habe der Autor Bruchstücke aus der Liebeskultur gefiltert und in eine zeitgemäße Form gebracht. Changierend zwischen Liebesbrief und Hasstirade, sei der Roman aber auch eine Auseinandersetzung mit Sören Kierkegaard. Auch anderen Lentz-"Hausgöttern" ist die Rezensentin im Roman begegnet (Freud und Kleist etwa), was sie aber nicht als "unziemliche Anbiederei" verstanden wissen will. Schließlich verdankt sie Lentz einige wundervolle Momente.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH