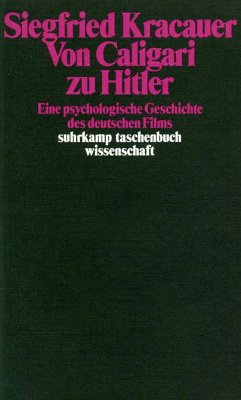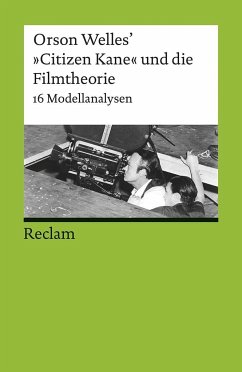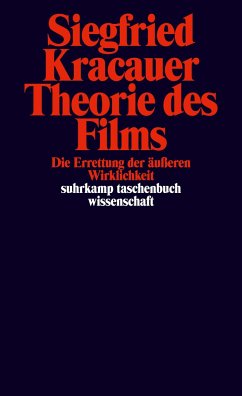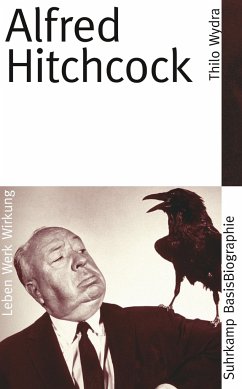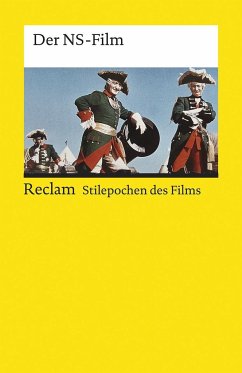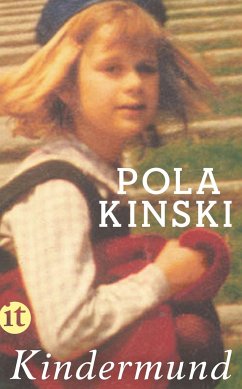Liebestod und Femme fatale
Der Austausch sozialer Energien zwischen Oper, Literatur und Film
Herausgegeben: Smith, Gary; Zill, Rüdiger
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
16,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Wie kommt es, daß ausgerechnet Shakespeare, der dem durchschnittlichen Kinogänger lediglich vom Namen her bekannt sein dürfte, zu einem der wichtigsten und erfolgreichsten »Drehbuchautoren« der amerikanischen Filmindustrie werden konnte? Und daß - weitgehend unbemerkt - die Anlage von Wagners Tristan und Isolde in den Plots des film noire bis heute weiterwirkt? Elisabeth Bronfen betreibt ein originelles und spannendes »cross-mapping« zwischen Theater, Oper und Film und leistet ganz nebenbei einen gewichtigen Beitrag zur Erforschung der durch diese Medien freigesetzten und als ästhetis...
Wie kommt es, daß ausgerechnet Shakespeare, der dem durchschnittlichen Kinogänger lediglich vom Namen her bekannt sein dürfte, zu einem der wichtigsten und erfolgreichsten »Drehbuchautoren« der amerikanischen Filmindustrie werden konnte? Und daß - weitgehend unbemerkt - die Anlage von Wagners Tristan und Isolde in den Plots des film noire bis heute weiterwirkt? Elisabeth Bronfen betreibt ein originelles und spannendes »cross-mapping« zwischen Theater, Oper und Film und leistet ganz nebenbei einen gewichtigen Beitrag zur Erforschung der durch diese Medien freigesetzten und als ästhetisches Lusterlebnis nutzbar gemachten psychischen Energien.