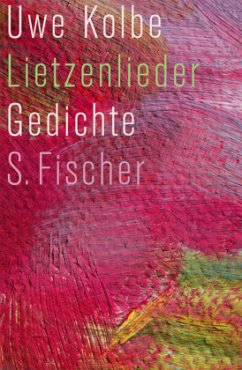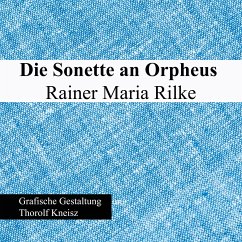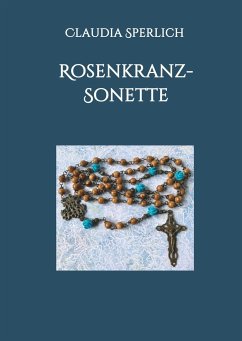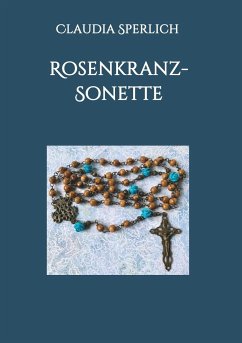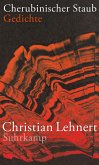Uwe Kolbe bleibt ein Suchender. Spielerisch und lustvoll erforscht er in Sonetten und freien Gedichten Gedanken und Erinnerungen. Vergleichend und assoziativ nähert er sich Fragen nach Heimat und Biographie, betrachtet Landschaften und Menschen, in den USA und Brandenburg. Auf dem Feld der Sprache wagt er sich vor, findet Leichtes und Schweres, zeigt immer wieder Überraschendes auf. Und beweist mit seinem neuen Gedichtband einmal mehr, dass er ein großer Kenner poetischer Traditionen und souveräner Sprachgestalter ist.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
"Wie schön hat da ein Dichter sein Dichten bedichtet!" jubelt Rezensent Hans-Herbert Räkel nach der Lektüre von Uwe Kolbes neuem Gedichtband "Lietzenlieder". Der Kritiker, der hier weniger den Band bespricht als vielmehr sorgsam interpretiert, erkennt in den auf acht Kapitel verteilten achtzig Gedichten nicht nur die Lust, sondern auch stets Kolbes Zweifel an der "Macht des Wortes". Nicht nur sprechen, sondern sagen zu können, sei die große Anforderung an den Dichter, konstatiert Räkel, der diese Aufgabe bei Kolbe - bis auf wenige Ausnahmen - vorbildhaft erfüllt sieht. Und so hat ihm dieser lyrische Lebenslauf, der Gedichte vom siebten bis zum 49. Lebensjahr Kolbes umfasst, den Glauben an das Dichten und Sagen zurückgegeben.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Uwe Kolbes neuer Gedichtband fragt nach Herkunft und Tradition, zwingt das widerspenstige Berlin ins strenge Gewand des Sonetts und singt mit den Blesshühnern.
Hineingeboren" - ein Wort, das Uwe Kolbe anhängt, seit er sich 1980 mit seinem ersten Gedichtband unter diesem Titel zu Wort meldete und damit einer Generation von jungen Schriftstellern der DDR die Chiffre ihres Selbstverständnisses lieferte: Sie hatten dieses Land nicht aufgebaut, sie mussten mit ihm, so gut es ging, zurechtkommen.
Es ging nicht gut. Sie quälten sich. Sie suchten, umstellt von Zwängen, ihren eigenen Weg, schlossen Kompromisse oder leisteten Widerstand, schlugen der allgegenwärtigen Zensur ein Schnippchen, bemühten sich um Anerkennung. Das alles und mehr von Lebensgefühl und Lebenspraxis der um 1960 in der DDR Geborenen umfasste Kolbes Begriff "Hineingeboren", der heute ein trockenes Diktum der Literaturgeschichte wäre, schleppten ihn nicht die Autoren selbst als Gepäck und Hintergrundmelodie ihres Werks mit sich herum. Für Kolbe, den Erfinder dieses Stichworts, gilt das in besonderem Maße. Er kommt nicht los vom Land seiner Sozialisation, allen neuen Erfahrungen zum Trotz. In seinen Büchern ist dieses Land stets präsent, auch im jüngsten Gedichtband "Lietzenlieder".
"Landnahme war es, hineingeboren, / Anmaßung, selbstverständlich." So beurteilt Kolbe heute die einstige Diagnose seines einstigen Landes in dem Gedicht "h.m.e. beim Wiederlesen". "landnahme" heißt eines der Gedichte aus Hans Magnus Enzensbergers Gedichtband "landessprache" (1960); darin die vielzitierten Verse: "mein land, ich verschone dich nicht, / ich halte dich, selber sterblich, / in dieses sterbliche licht". Kolbe kombiniert nachträglich den eigenen mit Enzensbergers Befund; mit ihm solidarisiert er sich so, als wären beide Unternehmungen vergleichbare Anmaßungen gewesen. Und ohne Scheu folgert der um über dreißig Jahre jüngere Kolbe: "Wir haben uns überlebt als Kommentatoren", als forsche Kämpfer, die ihre rostigen Helme "auf den bald kahlen Schädeln" tragen.
Konsequenterweise schließt Kolbes Gedicht mit dem Widerruf: "Dass ich mich angehörig wähnte / einer Generation, war damals ein Witz", wobei offenbleibt, ob die damalige Selbsteinschätzung als "Witz" qualifiziert wird oder ob es ein Irrtum war anzunehmen, es habe die Generation überhaupt gegeben, als deren Repräsentant Kolbe sich hätte fühlen dürfen. Auch Enzensberger kündigte bekanntlich seine Inanspruchnahme durch vermeintliche Sympathisanten auf, indem er sich zum "Fliegenden Robert" mauserte. Insofern beruft sich Uwe Kolbe zu Recht auf ihn: Auch seine Gedichte sind Orte uneinschränkbarer Freiheit, die er sich nicht (mehr) nehmen lässt.
Doch wie verträgt sich mit einer solchen Ortsbestimmung Kolbes desillusionierendes Bekenntnis "Ich glaube nicht mehr ans Gedicht"? Die Herzensangelegenheit Gedicht, die sogar pathetisch als das "Heilige" bezeichnet wird, ist der Ausnahmefall, der vom Glauben nicht erreicht werden kann. Das Gedicht gewährt weder Sicherheit noch Vertrauen, weder Zuverlässigkeit noch Heilserwartungen. Es ist, folgt man Kolbes Versen, das absolut Unsichere, Riskante, ja Unglaubwürdige. Gerade der Unglaube dem Gedicht gegenüber zeichnet es als das "Heilige" aus.
Nicht alle Gedichte aus Kolbes neuem Buch sind so gedankenschwer und provozierend dialektisch. Unter den "Lietzenliedern", einem Zyklus von fünfzehn Sonetten, finden sich auch lockere Spielereien; so reiht Kolbe beispielsweise, um "ein paar Freunde zu begrüßen", die Namen von 39 sorbischen Volksstämmen in alphabetischer Abfolge als "Tischkärtchen für Kito" (womit der sorbische Dichterfreund Kito Lorenc gemeint ist) aneinander und zwingt sie in die strenge Form des Sonetts. Selbst der Stadt Berlin geht es nicht besser: "Berlin liegt am Wasser, das ist ein Gedicht, / doch ein Sonett ist es selten bis nicht". Es geht prosaisch zu in Berlin: "wir führen den Hund aus am Schlachtensee / doch feinere lyrische Formen? Nee!" Und so schließt das Gedicht folgerichtig: "Berlin im Sonett, das bleibt illusorisch", womit witzigerweise gerade diese Behauptung widerlegt wird. Ganz neu ist diese Idee nicht. Sie gehört zum Grundbestand dichterischer Bemühungen in Deutschland seit dem Sonettenkrieg zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts. Zuletzt hat Robert Gernhardt mit seinen "Materialien zu einer Kritik der bekanntesten Gedichtform italienischen Ursprungs" ("Sonette find ich sowas von beschissen") ein vielzitiertes Exempel dieser Art statuiert.
Die Lieder der "Lietzen" (das sind für Nichtberliner schlicht Blesshühner) zeichnen sich durch eine große Varietät der Töne und Rufe aus, gelegentlich auch durch eher herbe Melodiosität. Diese Charakterisierung können auch Kolbes Gedichte für sich in Anspruch nehmen. Es geht in ihnen überwiegend um Fragen nach der Herkunft, der Tradition und der Zugehörigkeit. Im titelgebenden "Lietzenlied" wird das so formuliert: "in den Adern / in uns plätschern die unbekannten Ahnen. / Ob du es spürst, ist gleich, es bleibt doch wahr".
Als Schlussgedicht der fünfzehn Sonette kommt diesem Lietzenlied ein besonderes Gewicht zu. In zunächst deutlicher Anlehnung an das Abschlussgedicht eines Sonettenkranzes, das sich aus den Anfangsversen der vierzehn vorangegangenen Sonette zusammensetzt, summiert das "Lietzenlied" die Einzelaspekte der Gedichte zu einem poetischen Gesamtbild, das Preußisches und Slawisches, die Landschaft (den "wohlgeformten" Lietzensee) und die Musik (slawische Lieder), eine kritische Selbstreflexion (Blick in den Spiegel) und Unbewusstes (das "frühe Träumen") bis in die traditionelle Form des Sonetts hinein programmatisch miteinander verbindet: So, nämlich miteinander verbunden, ist es, und so soll es sein.
2007 ist dieser eindrucksvolle Sonettenzyklus mit fünfzehn Kaltnadelradierungen von Jean-Yves Klein als Künstlerbuch in winziger Auflage zuerst gedruckt worden. Jetzt setzt Uwe Kolbe mit einem "Curriculum vitae" ein: sieben autobiographischen Gedichte, deren Titel nur die Ziffer des jeweils erreichten Lebensalters des 1957 geborenen Dichters im siebenjährigen Abstand von 7 bis 49 angeben. Der Zyklus reicht bis ins Jahr 2006. Sollte es eine Fortsetzung dieser fortlaufenden lyrischen Selbstvergewisserung für den nächsten Lebensabschnitt geben, so wäre sie in diesem Jahr fällig. Bis dahin und darüber hinaus sind wir hinreichend und genussvoll beschäftigt mit Kolbes kunstreichen "Lietzenliedern".
WULF SEGEBRECHT
Uwe Kolbe:
"Lietzenlieder". Gedichte.
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2012. 112 S., geb.,16,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main