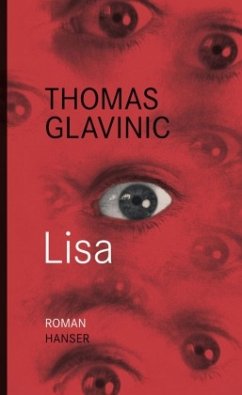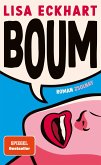Lisa, eine Schwerkriminelle, begeht auf der ganzen Welt rätselhafte Verbrechen. Die Zeichen mehren sich, dass ein Mann ihr nächstes Opfer wird: Sie ist bereits in seine Wohnung eingebrochen. Doch sie bleibt unsichtbar, außer ihrer DNA gibt es keine einzige Spur. Verschanzt in einem verlassenen Landhaus, mit reichlich Whiskey und Koks, spricht der Mann jeden Abend per Internet-Radio zu einem virtuellen Publikum. Komisch bis zum bitteren Ende erzählt Thomas Glavinic aus Österreich vom unsichtbaren Grauen der virtuellen Welt. "Lisa" ist ein Meisterwerk zwischen Humor und Horror, ein Psychogramm des Grauens. Denn Lisa ist überall.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Als hätten Houellebecq, Bret Easton Ellis und Wolf Haas sich auf den kleinsten gemeinsamen nihilistischen Nenner geeinigt: Thomas Glavinic hört einem Paranoiker zu und hat mit "Lisa" eine furiose Geschichte über das Banale und Böse geschrieben.
Nur den Fernseher haben die Einbrecher dagelassen. "War ein älteres Modell und zudem groß und sperrig und gestunken hat er, wenn er länger lief, weil mal die Käsesauce hinten reingeronnen ist." Allein für diese Idee muss man den neuen Roman des österreichischen Schriftstellers Thomas Glavinic bewundern. Dass Fernsehen meistens Käse ist und in flexiblen mobilen Zeiten außerdem ein Anachronismus, lässt sich kaum lakonischer in Szene setzen. Die Diebe haben also den Fernsehapparat ignoriert, dafür aber Dokumente und Ausweise mitgenommen. Der Bestohlene wird aus dieser Tatsache eine Weltsicht entwickeln, in der sich Angst, Ressentiments und Scharfsinn zu einem furiosen Gemisch vermengen.
Die Geburtsurkunde ist weg, der Personalausweis - das müsste nicht wirklich tragisch sein, wenn man am Tatort nicht DNA-Spuren einer Frau gefunden hätte. Diese Einbrecherin ist nicht irgendeine Kleinkriminelle, sondern, wie sich herausstellt, eine Verbrecherin von diabolisch-phantastischem Format. Ihre Gen-Fährte zeigt sie als Nomadin der Gewalt, die Europa mit Schreckenstaten überzieht: In Ungarn entführt sie eine Frau und erwürgt sie mit ihren eigenen Haaren, in Prag verübt sie zahlreiche Giftmorde, in der Nähe von Warschau hängt sie drei junge Adelige auf. In Genua schneidet sie einem Obdachlosen die Nieren heraus, bei Nantes wird ein alleinstehender Rentner in einem Topf mit seinen eigenen Eingeweiden erstickt.
Der Ich-Erzähler, ein frisch von der Frau getrennter Spieleentwickler, verschanzt sich mit seinem Sohn in einer entlegenen Berghütte. Die Furcht, von der Lisa getauften Killerin aufgestöbert zu werden, hat den Mann selbst in eine Furie verwandelt: eine Furie der Rhetorik, einen koksenden, Tabletten schluckenden und saufenden Schwadroneur, der per livestream täglich mehrere Stunden ins Internet sendet. Diese Suada ist das Buch, ein großer Monolog, in dem alles Mögliche zusammenkommt: eine Abrechnung mit der sich kultiviert wähnenden Mittelschicht, eine gnadenlose Vivisektion von Paarbeziehungen, eine Brandrede gegen den Kulturpessimismus, eine Feier neuer Technologien und auch die Geschichte der obsessiven Suche nach einem Sinn- und Erklärungsmuster, das sich auf das in der Welt marodierende Böse projizieren ließe.
Wenn da draußen das enthemmte Grauen um sich greift, dann muss die Sprache sich ebenfalls lockern, ausufern, böse und gewalttätig werden. Gemäß dem Benn-Wort, dass jene, die reden, noch nicht tot sind, stemmt sich hier einer mit chemisch hochgepeitschter Wut gegen die Angst. Wäre "Lisa" nun einfach der verbale Exzess eines einsamen Süchtigen, dann hätte man es mit einem tumben Thomas-Bernhard-Verschnitt zu tun, einer rasant hingetexteten Bösartigkeit. Aber Glavinic hat dieses sprachschnaubende Ich als derart unzuverlässige Größe angelegt, dass man als Leser auf der Hut sein muss. "Meinen Namen verrate ich nicht. Nennt mich Tom. Das ist eine Idee von mir. Ich bin eine Idee von Tom." Mit wem haben wir es also zu tun? Mit einem modernen Rumpelstilzchen? Mit dem personifizierten Weltgeist, der uns gehörig die Meinung geigt und am Ende den Ursprung alles Unheils enthüllt? Oder doch einfach nur mit dem Durchschnittsbürger, den ein paar Schicksalsschläge (der Einbruch, die Trennung) aus der Bahn geworfen haben?
Vom Ende des Buchs her gewinnt die Geschichte einen gespenstischen, ins Metaphysische ausgreifenden Sinn, aber man darf die Pointe nicht verraten. Der Text käme auch ohne sie aus; den dramaturgischen Fluchtpunkt einer Erklärung, die diese irre Story begründet, kann es vielleicht auch gar nicht geben. Denn "Lisa" ist das zwischen Wahn und Hellsicht pendelnde Selbstgespräch des Subjekts im Ausnahmezustand, der zum Status quo geworden ist. Die Existenz ist schrecklich, perfide und dabei von unerhörter Banalität, könnte man das Credo dieses Tom zusammenfassen. Als hätten Houellebecq, Bret Easton Ellis und Wolf Haas sich auf den kleinsten gemeinsamen nihilistischen Nenner geeinigt und den modernen Menschen noch einmal in seiner ganzen Selbstgerechtigkeit und Gier zu Wort kommen lassen.
Aber der Text ist noch mehr: Er ist eine Phrasendreschmaschine, die Klischees in ätzende Einsichten verwandelt, eine Stammtisch-Philippika, in der es vor grotesk komischen, widerlich treffenden Diagnosen zur unseren Gegenwartsverhältnissen nur so wimmelt. Zu allem hat der Webquassler eine Meinung: zu Taxifahrern ("Darf der Wagen so alt sein wie der Fahrer, wenn der Fahrer schon so alt ist wie mein Vater?"), Gourmets ("Früher hat man einfach gekocht, heute braucht man zum Glücklichsein unbedingt ein kaltgepresstes Öl und einen Fisch, dessen Namen man nicht mal buchstabieren kann"), Journalisten ("deren Berufsbezeichnung korrekterweise ,Mensch, der für alles unbegabt war und aufgrund nicht ganz schlechter Deutschnoten dachte, na werde ich eben Journalist' lauten müsste"), Amokläufern ("meistens die größten Trottel der Schule") und Performancekünstlern. Von denen heißt es: "Schneiden sich die Augenbrauen ab oder packen einfach ein Zimmer mit Abfall voll und schreiben dazu einen englischen Titel auf ein Schild." Und dann der phantastische, von nun an in allen nervigen, prätentiösen, durch Kunsthuberei verhunzten Zusammenkünften anzuwendende Satz: "Man müsste allen, die auf so etwas hereinfallen, nur mehr Wurst zu essen geben."
Abgesehen davon, dass die beiden Obervegetarier Karen Duve und Jonathan Safran Foer damit vorerst in die Schranken verwiesen sind: Der Fleischverzehr, vor allem in kannibalistischer Form, ist ein Leitmotiv in diesem Text. Lisa kocht ihre Opfer; ein durchgeknallter Wikingerdarsteller brät seinen Fuß; Toms Freund Mike beißt einem Flughafenbeamten ein Ohr ab. Solche Karnivoren sind Reflexe der Textidee selbst: Sie verwurstet wild die Populärkultur, den Trash, den Boulevard. Wenn Lisa zum Beispiel einem Wachmann die Haut abzieht und ihn in Denkerpose am Tatort zurücklässt, dann trifft "Das Schweigen der Lämmer" auf Gunther von Hagens. Der hat tatsächlich eine Figur "Der Denker" geschaffen.
Ist die Ansprache am Ende also doch eine aus Medienmüll kompilierte Verschwörungsphantasie? Was aber hätte der Ermittler Hilgert, ein Wiedergänger des besessenen Kommissars aus Dürrenmatts "Verdacht", dann herausgefunden, als er Hunderte von DNA-Proben von Frauen miteinander verglich? So wären wir wieder am Ende des Buchs, wo eine böse Überraschung lauert. Viel böser als erwartet.
DANIEL HAAS
Thomas Glavinic: "Lisa". Roman.
Hanser Verlag, München 2011. 204 S., geb., 17,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
Rezensent Rene Hamann fühlt sich von Thomas Glavinics neuen Roman "Lisa" in jedem Fall gut unterhalten. Es geht, so Hamann, um alles und nichts: der Protagonist, ein vierzigjähriger Computerspielentwickler, hat sich nach einer zerbrochenen Liebesbeziehung und auf der paranoiden Flucht vor der unbekannten, psychopathischen Serienmörderin Lisa in die österreichische Einöde zurückgezogen. "Unzensiert, ungebremst, befeuert von Alkohol und Kokain" erzählt er von dort aus in seinem eigenen Internetradio einfach drauf los: Facebook, Kulturpessimismus, Esoterik, Sarrazin - nichts wird ausgelassen. Hamann findet das größtenteils "witzig", kann aber über die Schwächen der Erzählung nicht hinwegsehen: die sich im Hintergrund abspielende Kriminalgeschichte schöpfe ihr Spannungspotential nicht aus, sondern ende vielmehr mit einer "hanebüchenen" Pointe. Auch dem Versuch des Autors, den mündlichen Redefluss möglichst authentisch wiederzugeben, konnte Hamann nicht viel abgewinnen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Als hätten Houellebecq, Bret Easton Ellis und Wolf Haas sich auf den kleinsten gemeinsamen nihilistischen Nenner geeinigt: Thomas Glavinic hört einem Paranoiker zu und hat mit 'Lisa' eine furiose Geschichte über das Banale und Böse geschrieben." Daniel Haas, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.02.11 "Unzensiert, ungebremst, befeuert von Alkohol und Kokain und größtenteils tatsächlich witzig - Thomas Glavinic' Ich-Erzähler ist sein eigenes Internetradio." René Hamann, die tageszeitung, 02.04.11 "Dieses Buch kann eigentlich alles, was man von einem Buch erwarten kann. Es ist spannend, witzig, böse, satirisch, interessant und mit atemberaubendem Schwung geschrieben. Was will man mehr." Caro Wiesauer, Kurier, 06.02.11 "Die Erzähung entwickelt eine Sogwirkung, ist enorm spannend, aber trotzdem immer auch komisch aufgrund der egozentrische-herzhaften Kommentare des Erzählers - bis einem das Lachen endgültig vergeht. " Magdi Aboul-Keir, Südwest Presse, 10.02.11
Zeter und Mordio!
Als hätten Houellebecq, Bret Easton Ellis und Wolf Haas sich auf den kleinsten gemeinsamen nihilistischen Nenner geeinigt: Thomas Glavinic hört einem Paranoiker zu und hat mit "Lisa" eine furiose Geschichte über das Banale und Böse geschrieben.
Nur den Fernseher haben die Einbrecher dagelassen. "War ein älteres Modell und zudem groß und sperrig und gestunken hat er, wenn er länger lief, weil mal die Käsesauce hinten reingeronnen ist." Allein für diese Idee muss man den neuen Roman des österreichischen Schriftstellers Thomas Glavinic bewundern. Dass Fernsehen meistens Käse ist und in flexiblen mobilen Zeiten außerdem ein Anachronismus, lässt sich kaum lakonischer in Szene setzen. Die Diebe haben also den Fernsehapparat ignoriert, dafür aber Dokumente und Ausweise mitgenommen. Der Bestohlene wird aus dieser Tatsache eine Weltsicht entwickeln, in der sich Angst, Ressentiments und Scharfsinn zu einem furiosen Gemisch vermengen.
Die Geburtsurkunde ist weg, der Personalausweis - das müsste nicht wirklich tragisch sein, wenn man am Tatort nicht DNA-Spuren einer Frau gefunden hätte. Diese Einbrecherin ist nicht irgendeine Kleinkriminelle, sondern, wie sich herausstellt, eine Verbrecherin von diabolisch-phantastischem Format. Ihre Gen-Fährte zeigt sie als Nomadin der Gewalt, die Europa mit Schreckenstaten überzieht: In Ungarn entführt sie eine Frau und erwürgt sie mit ihren eigenen Haaren, in Prag verübt sie zahlreiche Giftmorde, in der Nähe von Warschau hängt sie drei junge Adelige auf. In Genua schneidet sie einem Obdachlosen die Nieren heraus, bei Nantes wird ein alleinstehender Rentner in einem Topf mit seinen eigenen Eingeweiden erstickt.
Der Ich-Erzähler, ein frisch von der Frau getrennter Spieleentwickler, verschanzt sich mit seinem Sohn in einer entlegenen Berghütte. Die Furcht, von der Lisa getauften Killerin aufgestöbert zu werden, hat den Mann selbst in eine Furie verwandelt: eine Furie der Rhetorik, einen koksenden, Tabletten schluckenden und saufenden Schwadroneur, der per livestream täglich mehrere Stunden ins Internet sendet. Diese Suada ist das Buch, ein großer Monolog, in dem alles Mögliche zusammenkommt: eine Abrechnung mit der sich kultiviert wähnenden Mittelschicht, eine gnadenlose Vivisektion von Paarbeziehungen, eine Brandrede gegen den Kulturpessimismus, eine Feier neuer Technologien und auch die Geschichte der obsessiven Suche nach einem Sinn- und Erklärungsmuster, das sich auf das in der Welt marodierende Böse projizieren ließe.
Wenn da draußen das enthemmte Grauen um sich greift, dann muss die Sprache sich ebenfalls lockern, ausufern, böse und gewalttätig werden. Gemäß dem Benn-Wort, dass jene, die reden, noch nicht tot sind, stemmt sich hier einer mit chemisch hochgepeitschter Wut gegen die Angst. Wäre "Lisa" nun einfach der verbale Exzess eines einsamen Süchtigen, dann hätte man es mit einem tumben Thomas-Bernhard-Verschnitt zu tun, einer rasant hingetexteten Bösartigkeit. Aber Glavinic hat dieses sprachschnaubende Ich als derart unzuverlässige Größe angelegt, dass man als Leser auf der Hut sein muss. "Meinen Namen verrate ich nicht. Nennt mich Tom. Das ist eine Idee von mir. Ich bin eine Idee von Tom." Mit wem haben wir es also zu tun? Mit einem modernen Rumpelstilzchen? Mit dem personifizierten Weltgeist, der uns gehörig die Meinung geigt und am Ende den Ursprung alles Unheils enthüllt? Oder doch einfach nur mit dem Durchschnittsbürger, den ein paar Schicksalsschläge (der Einbruch, die Trennung) aus der Bahn geworfen haben?
Vom Ende des Buchs her gewinnt die Geschichte einen gespenstischen, ins Metaphysische ausgreifenden Sinn, aber man darf die Pointe nicht verraten. Der Text käme auch ohne sie aus; den dramaturgischen Fluchtpunkt einer Erklärung, die diese irre Story begründet, kann es vielleicht auch gar nicht geben. Denn "Lisa" ist das zwischen Wahn und Hellsicht pendelnde Selbstgespräch des Subjekts im Ausnahmezustand, der zum Status quo geworden ist. Die Existenz ist schrecklich, perfide und dabei von unerhörter Banalität, könnte man das Credo dieses Tom zusammenfassen. Als hätten Houellebecq, Bret Easton Ellis und Wolf Haas sich auf den kleinsten gemeinsamen nihilistischen Nenner geeinigt und den modernen Menschen noch einmal in seiner ganzen Selbstgerechtigkeit und Gier zu Wort kommen lassen.
Aber der Text ist noch mehr: Er ist eine Phrasendreschmaschine, die Klischees in ätzende Einsichten verwandelt, eine Stammtisch-Philippika, in der es vor grotesk komischen, widerlich treffenden Diagnosen zur unseren Gegenwartsverhältnissen nur so wimmelt. Zu allem hat der Webquassler eine Meinung: zu Taxifahrern ("Darf der Wagen so alt sein wie der Fahrer, wenn der Fahrer schon so alt ist wie mein Vater?"), Gourmets ("Früher hat man einfach gekocht, heute braucht man zum Glücklichsein unbedingt ein kaltgepresstes Öl und einen Fisch, dessen Namen man nicht mal buchstabieren kann"), Journalisten ("deren Berufsbezeichnung korrekterweise ,Mensch, der für alles unbegabt war und aufgrund nicht ganz schlechter Deutschnoten dachte, na werde ich eben Journalist' lauten müsste"), Amokläufern ("meistens die größten Trottel der Schule") und Performancekünstlern. Von denen heißt es: "Schneiden sich die Augenbrauen ab oder packen einfach ein Zimmer mit Abfall voll und schreiben dazu einen englischen Titel auf ein Schild." Und dann der phantastische, von nun an in allen nervigen, prätentiösen, durch Kunsthuberei verhunzten Zusammenkünften anzuwendende Satz: "Man müsste allen, die auf so etwas hereinfallen, nur mehr Wurst zu essen geben."
Abgesehen davon, dass die beiden Obervegetarier Karen Duve und Jonathan Safran Foer damit vorerst in die Schranken verwiesen sind: Der Fleischverzehr, vor allem in kannibalistischer Form, ist ein Leitmotiv in diesem Text. Lisa kocht ihre Opfer; ein durchgeknallter Wikingerdarsteller brät seinen Fuß; Toms Freund Mike beißt einem Flughafenbeamten ein Ohr ab. Solche Karnivoren sind Reflexe der Textidee selbst: Sie verwurstet wild die Populärkultur, den Trash, den Boulevard. Wenn Lisa zum Beispiel einem Wachmann die Haut abzieht und ihn in Denkerpose am Tatort zurücklässt, dann trifft "Das Schweigen der Lämmer" auf Gunther von Hagens. Der hat tatsächlich eine Figur "Der Denker" geschaffen.
Ist die Ansprache am Ende also doch eine aus Medienmüll kompilierte Verschwörungsphantasie? Was aber hätte der Ermittler Hilgert, ein Wiedergänger des besessenen Kommissars aus Dürrenmatts "Verdacht", dann herausgefunden, als er Hunderte von DNA-Proben von Frauen miteinander verglich? So wären wir wieder am Ende des Buchs, wo eine böse Überraschung lauert. Viel böser als erwartet.
DANIEL HAAS
Thomas Glavinic: "Lisa". Roman.
Hanser Verlag, München 2011. 204 S., geb., 17,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Als hätten Houellebecq, Bret Easton Ellis und Wolf Haas sich auf den kleinsten gemeinsamen nihilistischen Nenner geeinigt: Thomas Glavinic hört einem Paranoiker zu und hat mit "Lisa" eine furiose Geschichte über das Banale und Böse geschrieben.
Nur den Fernseher haben die Einbrecher dagelassen. "War ein älteres Modell und zudem groß und sperrig und gestunken hat er, wenn er länger lief, weil mal die Käsesauce hinten reingeronnen ist." Allein für diese Idee muss man den neuen Roman des österreichischen Schriftstellers Thomas Glavinic bewundern. Dass Fernsehen meistens Käse ist und in flexiblen mobilen Zeiten außerdem ein Anachronismus, lässt sich kaum lakonischer in Szene setzen. Die Diebe haben also den Fernsehapparat ignoriert, dafür aber Dokumente und Ausweise mitgenommen. Der Bestohlene wird aus dieser Tatsache eine Weltsicht entwickeln, in der sich Angst, Ressentiments und Scharfsinn zu einem furiosen Gemisch vermengen.
Die Geburtsurkunde ist weg, der Personalausweis - das müsste nicht wirklich tragisch sein, wenn man am Tatort nicht DNA-Spuren einer Frau gefunden hätte. Diese Einbrecherin ist nicht irgendeine Kleinkriminelle, sondern, wie sich herausstellt, eine Verbrecherin von diabolisch-phantastischem Format. Ihre Gen-Fährte zeigt sie als Nomadin der Gewalt, die Europa mit Schreckenstaten überzieht: In Ungarn entführt sie eine Frau und erwürgt sie mit ihren eigenen Haaren, in Prag verübt sie zahlreiche Giftmorde, in der Nähe von Warschau hängt sie drei junge Adelige auf. In Genua schneidet sie einem Obdachlosen die Nieren heraus, bei Nantes wird ein alleinstehender Rentner in einem Topf mit seinen eigenen Eingeweiden erstickt.
Der Ich-Erzähler, ein frisch von der Frau getrennter Spieleentwickler, verschanzt sich mit seinem Sohn in einer entlegenen Berghütte. Die Furcht, von der Lisa getauften Killerin aufgestöbert zu werden, hat den Mann selbst in eine Furie verwandelt: eine Furie der Rhetorik, einen koksenden, Tabletten schluckenden und saufenden Schwadroneur, der per livestream täglich mehrere Stunden ins Internet sendet. Diese Suada ist das Buch, ein großer Monolog, in dem alles Mögliche zusammenkommt: eine Abrechnung mit der sich kultiviert wähnenden Mittelschicht, eine gnadenlose Vivisektion von Paarbeziehungen, eine Brandrede gegen den Kulturpessimismus, eine Feier neuer Technologien und auch die Geschichte der obsessiven Suche nach einem Sinn- und Erklärungsmuster, das sich auf das in der Welt marodierende Böse projizieren ließe.
Wenn da draußen das enthemmte Grauen um sich greift, dann muss die Sprache sich ebenfalls lockern, ausufern, böse und gewalttätig werden. Gemäß dem Benn-Wort, dass jene, die reden, noch nicht tot sind, stemmt sich hier einer mit chemisch hochgepeitschter Wut gegen die Angst. Wäre "Lisa" nun einfach der verbale Exzess eines einsamen Süchtigen, dann hätte man es mit einem tumben Thomas-Bernhard-Verschnitt zu tun, einer rasant hingetexteten Bösartigkeit. Aber Glavinic hat dieses sprachschnaubende Ich als derart unzuverlässige Größe angelegt, dass man als Leser auf der Hut sein muss. "Meinen Namen verrate ich nicht. Nennt mich Tom. Das ist eine Idee von mir. Ich bin eine Idee von Tom." Mit wem haben wir es also zu tun? Mit einem modernen Rumpelstilzchen? Mit dem personifizierten Weltgeist, der uns gehörig die Meinung geigt und am Ende den Ursprung alles Unheils enthüllt? Oder doch einfach nur mit dem Durchschnittsbürger, den ein paar Schicksalsschläge (der Einbruch, die Trennung) aus der Bahn geworfen haben?
Vom Ende des Buchs her gewinnt die Geschichte einen gespenstischen, ins Metaphysische ausgreifenden Sinn, aber man darf die Pointe nicht verraten. Der Text käme auch ohne sie aus; den dramaturgischen Fluchtpunkt einer Erklärung, die diese irre Story begründet, kann es vielleicht auch gar nicht geben. Denn "Lisa" ist das zwischen Wahn und Hellsicht pendelnde Selbstgespräch des Subjekts im Ausnahmezustand, der zum Status quo geworden ist. Die Existenz ist schrecklich, perfide und dabei von unerhörter Banalität, könnte man das Credo dieses Tom zusammenfassen. Als hätten Houellebecq, Bret Easton Ellis und Wolf Haas sich auf den kleinsten gemeinsamen nihilistischen Nenner geeinigt und den modernen Menschen noch einmal in seiner ganzen Selbstgerechtigkeit und Gier zu Wort kommen lassen.
Aber der Text ist noch mehr: Er ist eine Phrasendreschmaschine, die Klischees in ätzende Einsichten verwandelt, eine Stammtisch-Philippika, in der es vor grotesk komischen, widerlich treffenden Diagnosen zur unseren Gegenwartsverhältnissen nur so wimmelt. Zu allem hat der Webquassler eine Meinung: zu Taxifahrern ("Darf der Wagen so alt sein wie der Fahrer, wenn der Fahrer schon so alt ist wie mein Vater?"), Gourmets ("Früher hat man einfach gekocht, heute braucht man zum Glücklichsein unbedingt ein kaltgepresstes Öl und einen Fisch, dessen Namen man nicht mal buchstabieren kann"), Journalisten ("deren Berufsbezeichnung korrekterweise ,Mensch, der für alles unbegabt war und aufgrund nicht ganz schlechter Deutschnoten dachte, na werde ich eben Journalist' lauten müsste"), Amokläufern ("meistens die größten Trottel der Schule") und Performancekünstlern. Von denen heißt es: "Schneiden sich die Augenbrauen ab oder packen einfach ein Zimmer mit Abfall voll und schreiben dazu einen englischen Titel auf ein Schild." Und dann der phantastische, von nun an in allen nervigen, prätentiösen, durch Kunsthuberei verhunzten Zusammenkünften anzuwendende Satz: "Man müsste allen, die auf so etwas hereinfallen, nur mehr Wurst zu essen geben."
Abgesehen davon, dass die beiden Obervegetarier Karen Duve und Jonathan Safran Foer damit vorerst in die Schranken verwiesen sind: Der Fleischverzehr, vor allem in kannibalistischer Form, ist ein Leitmotiv in diesem Text. Lisa kocht ihre Opfer; ein durchgeknallter Wikingerdarsteller brät seinen Fuß; Toms Freund Mike beißt einem Flughafenbeamten ein Ohr ab. Solche Karnivoren sind Reflexe der Textidee selbst: Sie verwurstet wild die Populärkultur, den Trash, den Boulevard. Wenn Lisa zum Beispiel einem Wachmann die Haut abzieht und ihn in Denkerpose am Tatort zurücklässt, dann trifft "Das Schweigen der Lämmer" auf Gunther von Hagens. Der hat tatsächlich eine Figur "Der Denker" geschaffen.
Ist die Ansprache am Ende also doch eine aus Medienmüll kompilierte Verschwörungsphantasie? Was aber hätte der Ermittler Hilgert, ein Wiedergänger des besessenen Kommissars aus Dürrenmatts "Verdacht", dann herausgefunden, als er Hunderte von DNA-Proben von Frauen miteinander verglich? So wären wir wieder am Ende des Buchs, wo eine böse Überraschung lauert. Viel böser als erwartet.
DANIEL HAAS
Thomas Glavinic: "Lisa". Roman.
Hanser Verlag, München 2011. 204 S., geb., 17,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main