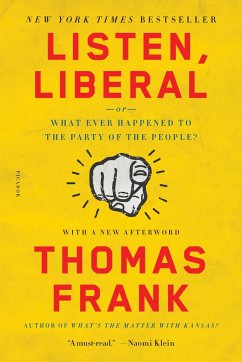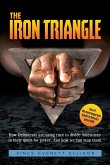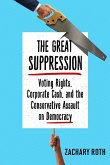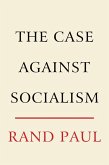A SCATHING LOOK AT THE STANDARD-BEARERS OF LIBERAL POLITICS-A BOOK THAT ASKS: WHAT'S THE MATTER WITH DEMOCRATS? Hailed as "the most prescient book" of the year, Listen, Liberal accurately described what ailed the Democratic Party even before the election of 2016 made their weaknesses obvious. It is the story of how the "Party of the People" detached itself from its historic constituency among average Americans and chose instead to line up with the winners of our new economic order. Now with a new afterword, Thomas Frank's powerful analysis offers the best diagnosis to date of the liberal malady. Drawing on years of research and firsthand reporting, Frank points out that the Democrats have over the last decades increasingly abandoned their traditional goals: expanding opportunity, fighting for social justice, and ensuring that workers get a fair deal. With sardonic wit and lacerating logic, he uncovers the corporate and cultural elitism that have largely eclipsed the party's old working- and middle-class commitment. And he warns that the Democrats' only chance of regaining their health and averting a future of ever-increasing inequality is a return to their historic faith.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Der Journalist Thomas Frank rechnet mit den Demokraten ab und seziert in "Listen, Liberal" die Verfehlungen der Clinton-Ära
Falls Donald Trump am 8. November zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wird, scheint nur eines sicher: Eine Menge Amerikaner hätte gegen ihre eigenen Interessen gestimmt. Warum sollte jemand, dessen Job es ist, bei Walmart die Kunden an der Tür zu begrüßen, einem Kandidaten seine Stimme geben, dessen zentrale Botschaft, von dumpfen Ressentiments einmal abgesehen, in der Apotheose des Unternehmers als Arschloch besteht? Überhaupt nicht - sofern seine Entscheidung auch nur auf einem Quentchen ökonomischer Vernunft beruht. Doch davon scheint bei vielen Angehörigen der weißen amerikanischen Unterschicht keine Rede zu sein.
Die Überzeugung, dass sich, zumal in den prekären Zonen der Gesellschaft, Solidarität gegen Konkurrenz bewährt, gehört offenbar nicht in ihren Vorstellungskreis. Darin liegt bestimmt ein spezifisch amerikanisches Moment. Die Arbeiterbewegung hat es in den Vereinigten Staaten zwar zu militanten Streiks, aber weder zu einer brauchbaren Ideologie noch zu einer Partei gebracht. Dass Franklin D. Roosevelt den New Deal in den dreißiger Jahren teilweise gegen den Widerstand lokaler Gewerkschaften durchsetzen musste, mutet aus europäischer Perspektive wie ein tragischer Irrtum an. Doch die amerikanische Ideologie, dass man die Dinge lieber selbst erledigt, als sie der Regierung zu überlassen, schlägt auf amerikanischem Boden in alle Milieus und Schichten durch.
Spätestens seit dem Brexit und den Wahlerfolgen der AfD scheint das Phänomen, das Trump verkörpert, aber kein rein amerikanisches mehr zu sein. Von der englischen Labour Party bis zur Berliner SPD fragen sich zumal die europäischen Sozialdemokraten: Was ist um Himmels willen mit den Leuten los? Gut möglich, dass wir 2016 als das Jahr erinnern werden, in dem der lange ausrangierte Begriff der "Klasse" in unser politisches Vokabular zurückfand.
Zu den meistdiskutierten Titeln dieses Sommers gehörte das im Original schon 2009 erschienene Buch, das der französische Soziologe Didier Eribon über seine lange verleugnete Herkunft aus der französischen Arbeiterklasse geschrieben hat. In "Rückkehr nach Reims" schildert er nicht nur die Härte und das Elend des Lebens in dürftigen Sozialbauwohnungen, sondern auch die politische Kontinentalverschiebung, die sich unter seinen Verwandten ereignet hat: Bis in die neunziger Jahre wählten sie die Kommunisten. Heute stimmen sie geschlossen für den Front National. Die Resonanz, die Eribons Bericht auslöste, hatte mit seiner eindrucksvollen Mischung aus Sachlichkeit und Empathie zu tun. Statt den politischen Irrweg seiner Eltern und Brüder schlicht als Rassismus zu skandalisieren oder als Verblendung abzutun, plädierte er dafür, sich eingehender mit seinen Hintergründen zu befassen.
Mit Blick auf die Vereinigten Staaten bietet dazu jetzt "Listen, Liberal: Or, What Ever Happened to the Party of the People?" Gelegenheit, das neue Buch des liberalen Publizisten und Historikers Thomas Frank. Schon 2004 gelang ihm mit "What's the Matter with Kansas?" ein Bestseller über die Anatomie des konservativen Populismus, der für die bevorstehende Wiederwahl des republikanischen Präsidenten George W. Bush in einigen der ärmsten, traditionell demokratisch wählenden Counties seines Heimatstaats Kansas verantwortlich war. Das Rezept bestand darin, den wirtschaftspolitischen Raubbau durch einen konservativen Kulturkampf zu verschleiern. Ein Dutzend Jahre und drei Präsidentschaftswahlen später führt Donald Trump der überrumpelten Grand Old Party jetzt die mindestens übernächste Eskalationsstufe dieser zynischen Arithmetik vor.
Während sich die Republikaner zu Bushs Zeiten noch auf konservative Werte mit Universalitätsanspruch wie ein Ja zu Gott oder ein Nein zur Abtreibung beriefen, betreibt Trump aggressive weiße Identitätspolitik. Mit seinem vermeintlichen unternehmerischen Erfolg und seinem hochgereckten Mittelfinger, den er sogar dem rechten Establishment entgegenhält, spielt er selbst dabei die Rolle einer Projektionsfläche. Statt über Inhalte vermag er seine Wähler über einen Mechanismus der Identifikation zu gewinnen, der Sehnsüchte symbolisch befriedigt, statt Bedürfnisse materiell zu erfüllen. Damit fallen sie einer Strategie zum Opfer, die Walter Benjamin in einer anderen Variante in den dreißiger Jahren als "Ästhetisierung der Politik" bezeichnet hat.
Doch gehen derlei Überlegungen dem Geheimnis von Trumps Erfolg bestenfalls zur Hälfte auf den Grund. In seinem aktuellen Buch wendet sich Thomas Frank daher seinem politischen Gegner zu. "Listen, Liberal" ist ein Schwarzbuch der Partei der Demokraten seit der Clinton-Ära. Es erzählt, wie sie das Erbe des New Deal verspielte und ihre angestammte Klientel, die amerikanische Arbeiterklasse, verriet. Als Präsident des Freihandels, der Sozialstaatskürzungen und der Deregulierung des Bankenwesens stand Bill Clinton für eine Politik, wie sie in England Tony Blair und in Deutschland der Agenda-Kanzler Gerhard Schröder vertraten. Getragen von der Euphorie, die die New Economy auslöste, vollendete er das neoliberale Abbruchwerk, das sein Vorgänger Reagan begonnen hatte. Das konnte nur ein Exponent der Linken tun.
In Gestalt der Subprime-Krise folgte die Rechnung für die finanzpolitischen Verfehlungen des Clintonismus. Doch anstatt die Banken zur Rechenschaft zu ziehen, setzte der frisch gewählte Demokrat Obama den von seinem Vorgänger Bush in die Wege geleiteten Bail-out der Wall Street fort. Folgt man Frank, dann wurde in diesem Moment eine bittere Wahrheit offenbar: Seit 2009 ist klar, dass die Demokraten nicht aus taktischen Überlegungen, sondern aus voller Überzeugung wie eine neoliberale Partei agieren, weil diese Agenda ihrer neuen Ideologie entspricht.
Wer glaubt, dass Hillary Clinton die Interessen des Finanzkapitals vertritt, wird bei Frank jede Menge Belege finden. Mit unverhohlenem Ingrimm zeichnet er die Physiognomie eines neuen liberalen Establishments, das in dem Selbstverständnis operiert, jenseits der veralteten Ideologien des 20. Jahrhunderts mit der Zukunft selbst im Bund zu sein. Wenn es nur gelingt, so der der Obama-Administration zugrundeliegende Mut zur Hoffnung, die besten Ivy-Leage-Absolventen an einen Tisch zu kriegen, dann werden sich die vernünftigsten Lösungen von selbst ergeben - was in der Logik des postideologischen Zeitalters zumeist die Freisetzung von Märkten meint.
Mitunter gerät Frank in die Nähe eines rechten Populismus, der mit dem Schreckgespenst einer liberalen Weltherrschaft hausieren geht. Der wichtige Unterschied besteht darin, dass er keine Verschwörungstheorie in Umlauf bringt, sondern die Ideologie einer meritokratischen Elite auseinandernimmt, die verleugnet, dass Politik aus einander widerstreitenden Interessen besteht.
Das tut sie zum Nachsehen der amerikanischen Arbeiterklasse, die seit dem Relaunch der Demokraten niemanden mehr hat, der ihre Anliegen in Washington vertritt. In dieses Vakuum der Repräsentation ist Donald Trump gestoßen. Dass einem in der Wolle gefärbten Demokraten pünktlich zur Wahl nichts Besseres einfällt, als seiner Partei das Misstrauen auszusprechen, zeigt, wie düster die Aussicht für viele Amerikaner ist.
PHILIPP FELSCH
Thomas Frank: "Listen, Liberal: Or, What Ever Happened to the Party of the People?" Scribe Publications, 320 Seiten, 8,99 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main