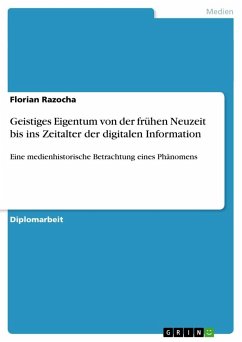Die medientechnologische Entwicklung der letzten Jahrzehnte hat auch das wissenschaftliche und literarische Arbeiten revolutioniert. Öffentliche Plagiatsdebatten um 'die Fälle' zu Guttenberg oder Helene Hegemann, aber auch der an den Universitäten schwelende Kampf um Open Access haben die Frage, ob das 21. Jahrhundert ein neues Urheberrechtsdenken braucht, ins Zentrum der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit gerückt.In gewohnter Prägnanz und Scharfzüngigkeit begleitet der Spezialist auf dem Gebiet des Plagiats die aktuellen Diskussionen mit seinen eigenen Überlegungen und legt ihre Hintergründe offen. Sein Plädoyer für eine neue Textethik im digitalen Zeitalter versteht sich als konstruktiver Beitrag zur öffentlichen und politischen Diskussion.
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Interessiert hat Rezensent Uwe Justus Wenzel die nun unter dem Titel "Literarisches Eigentum" erschienenen Ausführungen des Literatur- und Kulturwissenschaftlers Philipp Theisohn "Zur Ethik geistiger Arbeit im digitalen Zeitalter" gelesen. Die Ursache für den von Theisohn diagnostizierten, verstärkten "Plagiarismus" der Gegenwart sehe der Autor darin, dass wir als "computerisierte User" die Anstrengungen eigener Lese- und Denkerfahrungen an das "Informationsmeer" Internet abgegeben hätten und so verleitet würden, Texte ohne den Nachvollzug kompletter Gedankengänge nur noch unter dem Aspekt der Verwertbarkeit von Informationssplittern zu rezipieren. Gehaltvoller als den Appell an einen respektvolleren Umgang mit der Autorschaft findet der Kritiker aber Theisohns anhand von Beispielen aus Kunst, Politik und Wissenschaft vollzogene Analyse der Verantwortungslosigkeit.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Philipp Theisohn führt in einem exzellenten Essay vor Augen, was sich aus prominenten Plagiatsfällen über den Umgang mit geistiger Arbeit im digitalen Zeitalter lernen lässt
Was haben die Titel "Informationeller Globalismus ... am Beispiel des elektronischen Geschäftsverkehrs", "Historische Währungsunion zwischen Wirtschaft und Politik" und "Ökologische Modernisierung der PVC-Branche in Deutschland" gemeinsam? Es sind Dissertationen dreier Politiker, die in den letzten Jahren in Plagiatsverdacht gerieten. Es sind Arbeiten, die von ihren Autoren in dem Bewusstsein geschrieben wurden, dass kaum jemand sie lesen würde. Und es sind Texte, zu denen ihre Autoren vermutlich selbst kein besonders inniges Verhältnis hatten. Genau hier liegt die tiefere Ursache des anschwellenden Plagiarismus: in der Indifferenz zwischen Publikum, Autor und Text.
Zwischen dem Heer der anonymen Plagiatsjäger im Internet, die Texte in die Form von Strichcodes bringen, und den öffentlichen Talkshow-Tribunalen, in denen die Tabellen und Graphen als Beweis und Lektüreersatz herumgereicht werden, versinkt der Text wie in einem Abgrund. Einmal geht es um einen Verdacht, der auszuräumen oder zu bestätigen ist, das andere Mal um eine Persönlichkeit, die zu entwerten oder zu bestätigen ist, und zuletzt um einen Titel und ein Amt, die zu verteidigen sind. Worum es durchweg nicht geht, ist das Verständnis des Textes.
Sollte es darum gehen? Reicht beim Plagiat nicht das formale Kriterium? Der Züricher Literaturwissenschaftler Philipp Theisohn, der vor einigen Jahren schon eine gewichtige Literaturgeschichte des Plagiats vorlegte, hat in einem glänzenden Essay die strukturellen Ursachen hinter den Plagiatsfällen herausgearbeitet. Er verneint die zweite Frage, weil er das Plagiatsverfahren in einer zunächst leicht überzogen wirkenden Form als Paradigma für den allgemeinen Umgang mit geistiger Arbeit betrachtet. Es hat sich hier etwas fundamental geändert. Die Tendenz geht insgesamt auf die bloße Kenntnisnahme von gesichtslosen Texten, an denen nur die nackte Existenz interessiert.
Der Kern des Problems, das zeigen die Plagiatsverfahren wie im Brennglas, ist die Umwandlung von Texten in Informationen, in kontextfreie, modulartige Bausteine, die den Bezug zu ihrem geistigen Schöpfer nicht mehr erkennen lassen und den Sinn für seine geistige Arbeit erodieren. Die informationelle Lesart bedeutet eine Entsubjektivierung. Der Text verliert seine individuelle Form und löst sich auf in eine konturlose Masse für objektiv gehaltener Bausteine, die nicht mehr gedeutet, sondern nur noch verwendet werden wollen. Plagiatsverfahren sind bei Theisohn Musterbeispiele dieser rein mathematischen "Lektüre".
Im Fall Guttenberg, der seine politische Karriere schon ganz unabhängig von seiner wissenschaftlichen Verfehlung glaubte, war die Entfremdung des Autors von seinem Text in Extremform zu erleben: als Schizophrenie eines Mannes, der sich vom Eingeständnis seines Regelverstoßes als Akademiker Nachsicht für seine Rolle als Politiker versprach.
Beim Politiker wird die Delegation des Schreibens üblicherweise nicht beanstandet. Politikerreden behaupten weder originäre Erkenntnis noch persönliche Autorschaft. Für problematisch hält Theisohn das Delegationsprinzip aber schon. Politiker, die nicht schreiben, hätten keinen Sinn für den Widerstand der Realität bei der Umformung in Sprache. Ein laxer Umgang mit dem Urheberrecht sei die logische Konsequenz. Auf der einen Seite sieht man den hilflos überforderten Doktoranden im Meer der Daten schwimmen, auf der anderen Seite steht der Minister, der Wissenspartikel charismatisch färbt und sie allein deshalb für die eigenen hält.
Theisohn folgt den Spaltlinien mit sicherem Gespür für ihre paradoxen Effekte. Auf dem Feld der Literatur zeigt er an einer mustergültigen Nachbearbeitung des Falls Hegemann, welche Folgen der Unterscheidungsverlust zwischen äußerer und literarischer Wirklichkeit auf ästhetischer und materieller Ebene hat. Man sieht eine Autorin, die sich von einer vollkommen vorgestalteten Welt umgeben fühlt und meint, nur noch schöpferisch tätig sein zu können, wenn sie frei von urheberrechtlichen Hindernissen in diesen Fertigbaukasten hineingreifen kann, während sie sich andererseits als bloße Quersumme äußerer Einflüsse ausgibt. Auf der dritten Ebene, der des Romans, werden die jungen Helden schließlich von unverdauten Realitäts- und Theoriebrocken verschluckt, ohne eine geistige Zutat erkennen zu lassen. Es endet in dem Paradox, dass einerseits ein Naturrecht auf Kopie reklamiert wird, während das Recht, aus der geistigen Arbeit bei der Umformung der Natur ein Eigentumsrecht abzuleiten, bestritten wird. Und bei dem Widerspruch, dass eine Autorin ihre Persönlichkeit für den Schreibprozess völlig negiert, während sie auf dem literarischen Markt ein starkes Ego problemlos für sich in Anspruch nimmt, soundverstärkt als Stimme einer Generation.
Das allgemeine Problem, so Theisohn, liegt in einem Umfeld, das Literatur nur nach formalen Kriterien bemisst. Die größte Gefahr sieht er von Texten ausgehen, die äußeren Kriterien genügen, aber keinen Funken Individualität und Engagement mehr erkennen lassen. Solche Literatur darf nicht damit rechnen, dass ihr Anspruch auf Anerkennung als geistiges Eigentum Gehör findet.
Theisohns Plädoyer für eine neue, hermeneutisch inspirierte Textethik kann man nur unterschreiben. Aber er weiß auch, dass das ethische Problem in vielem ein medientechnisches ist. Dahinter steht das posthumanistische Medium, das an der Entgrenzung und Neutralisierung der Texte arbeitet. Wenn man die Wirklichkeit komplett im digitalen Speichermedium aufgehoben meint, wächst auch der Glaube, die Informationsbestände nur noch neu verknüpfen zu müssen. Weil die Maschinen dabei die Hauptarbeit übernehmen, verliert sich der Gedanke von Arbeit als geformter Natur wie der eines daraus erwachsenen geistigen Eigentums. Das Urheberrechtsproblem ist nur ein Schattengewächs der Formatierung des Geistes.
THOMAS THIEL
Philipp Theisohn: "Literarisches Eigentum". Zur Ethik geistiger Arbeit im digitalen Zeitalter.
Kröner Verlag, Stuttgart 2012. 132 S., br., 11,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main