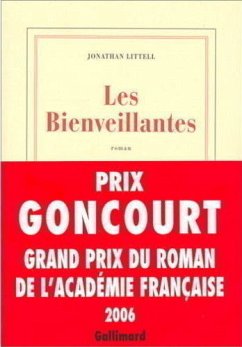Fiktive Lebenserinnerungen eines Offiziers der Waffen-SS, der für die Organisation der "Endlösung" zuständig war. Auch Jahre später zeigt er keine Reue, sondern bedauert vielmehr, seine Mission nicht vollständig erreicht zu haben. Dieser Erstlingsroman mit einer schwindelerregenden Beschreibung des Bösen war in Frankreich ein Überraschungserfolg. Grand prix du roman de l'Académie française 2006 sowie Prix Goncourt 2006.

Beste Kritiken, Spitzenverkaufszahlen - was taugt Jonathan Littells "Les Bienveillantes"? / Von Sylvain Bourmeau
Ich erinnere mich an den Moment - es war im Juni -, an dem ich "Les Bienveillantes" aufschlug. Und wenn ich so eine klare Erinnerung an diesen Augenblick habe, dann liegt das nicht daran, daß mir mein Gedächtnis einen Streich spielt, weil sich dieses Buch anschließend zu so einem phänomenalen Erfolg gemausert hat. Ich erinnere mich daran, daß ich über den Autor nichts wußte, im Unterschied zu den Dutzenden und Aberdutzenden von anderen Titeln, mit denen ich mich während der Rentrée Littéraire herumschlagen mußte, einer Jahreszeit, die es nur in Frankreich gibt und auf die ich gern verzichten würde, beschert sie uns doch Jahr für Jahr Hunderte schlechter Romane, die sich wie Geröll zwischen die wenigen tollen Bücher und den Leser legen. Wenn ich mich also so gut an "Les Bienveillantes" erinnere, dann liegt das schlicht daran, daß es sich um ein sehr dickes Buch handelt, es war in jenem Sommer das dickste von allen mit seinen neunhundert eng bedruckten Seiten, unter dem berühmten, in letzter Zeit aber nicht immer für literarische Qualität bürgenden weißen Deckel von Gallimard.
Und dann erinnere ich mich an den Ärger, der sich bei mir schon nach der Lektüre weniger Zeilen einstellte. So beginnt es: "Menschenbrüder, laßt mich euch erzählen, wie es sich zugetragen hat." Hätte Sie so ein schulischer Ton, der jede Ironie, jede Verspieltheit zurückweist, nicht auch geärgert? Die ungeschickte Anspielung auf François Villon erinnerte mich auf ungute Weise an ein Oberstufenlesebuch. Aber Menschenbrüder und Leser, das war noch gar nichts. Schauen Sie mal auf den zweiten Satz: "Wir sind nicht deine Brüder, werden sie antworten, und wir wollen es gar nicht hören!" Da kommt, in nur zwei Zeilen, doch echt was zusammen und läßt nichts Gutes erahnen. Der vierte Satz ist dann: "Es könnte ein wenig dauern, denn schließlich ist viel passiert, aber vielleicht haben Sie es ja nicht eilig und mit etwas Glück haben Sie sogar Zeit." Leider nicht, lieber Autor, ich hatte es in der Rentrée wie immer sehr eilig, zu eilig jedenfalls, um einem Roman, der so schwerfällig beginnt, eine Chance zu geben.
So probiere ich immer Erstlingsromane: ohne zu wissen, wer der Autor ist oder wovon das Buch handelt, wie bei einer Weinprobe, bei der die Etiketten von den Flaschen entfernt wurden. Ich habe in diesem Fall ziemlich schnell ausgespuckt, es blieb bloß eine Ahnung von Fusel im Abgang. Erst hinterher habe ich einen Blick auf das Etikett, in diesem Fall den Buchumschlag, geworfen. Und nun wurden die Dinge kompliziert.
Im verdrechselten Stil, den heute auch die Weinhändler pflegen, erklärte uns Chateau Gallimard, diese Edeltraube sei unter der Sonne eines Aischylos gereift und habe Tannine entwickelt, die an jene eines Vassili Grossmann erinnerten, nicht weniger. Nun erst verstand ich, daß der, der sich an uns Menschenbrüder wendet, ein hochrangiger Nazioffizier ist, der sich anschickt, uns vom Krieg zu erzählen, so wie er ihn erlebt hat, als Henker nämlich. All diese Informationen rührten an mein Gewissen, ich nahm das schwere Buch wieder zur Hand, und der Albtraum begann.
Vier Monate nach dieser anstrengenden Leseerfahrung hat sich das Buch, von der Presse einhellig als Meisterwerk begrüßt, in Frankreich über 200 000 Mal verkauft, und es heißt, für die deutschen Rechte seien einige hunderttausend Euro gezahlt worden, für die englischen eine Million Dollar. Wie konnte es dazu kommen?
Soviel wurde in Frankreich schon über das Buch und seinen 39jährigen Autor geschrieben, daß man, um den Blick freizuhalten, verschiedene Ebenen unterscheiden muß. Obwohl ich ihm nach wie vor nur eine mittelmäßige Qualität zubilligen kann, rührt "Les Bienveillantes" doch an äußerst spannende ästhetische, historiographische, moralische und selbst ökonomische Fragen.
Reden wir zunächst von der Ästhetik, damit fange ich ja, wie gesagt, immer an, und ich will auch gar nicht lange auf dem Punkt beharren, denn wer ein wenig in "Les Bienveillantes" herumliest, versteht sofort, was ich meine. Trotzdem frage ich mich natürlich, wie es kommt, daß einer im Jahre 2006 schreibt wie im 19. Jahrhundert, als habe es Proust, Joyce, Hammett, Faulkner und Robbe-Grillet nie gegeben, von Rushdie oder Toni Morrison oder Houellebecq ganz zu schweigen. Kann man sich einen Künstler vorstellen, der heute wie Monet malt? Da ist die Literatur schon bizarr, es ist die Kunstgattung, die am wenigsten über ihre eigene Geschichte nachdenkt. Littell hat da schon einen wahnwitzigen Anachronismus hingelegt: Er schreibt einen Roman über die Schoa, wie man ihn ein gutes Jahrhundert vor diesem Ereignis geschrieben hätte - wo doch die Schoa selbst und auf ewig die Literatur verändert hat.
Das berührt auch die historiographische Dimension des Buches. Ich bin kein Experte der Holocaust-Forschung und schließe mich dem Urteil Claude Lanzmanns an, der in einer ansonsten sehr ernsten Besprechung des Buches bemerkt hat, einzig er selbst, der Macher der "Schoa"-Dokumentation, und Raul Hilberg könnten "Les Bienveillantes" vollends verstehen. Das Buch ist also von einer nachgerade furchterregenden Präzision. Damit kann man Littell also nicht beikommen, man kann höchstens bemerken, daß er nichts wirklich Neues bringt, was einem deutschen Publikum, das in der Diskussion dieser Fragen ja noch ein höheres Niveau erreicht hat, noch stärker auffallen dürfte.
Trotzdem hat ein großes französisches Nachrichtenmagazin, "Le Nouvel Observateur", dessen Chefredakteur - in einer sehr französischen Wendung der Dinge - ebenfalls Gallimard-Autor ist, das Buch als Meisterwerk gefeiert - und brachte dazu eine Titelgeschichte über die "wahre Geschichte der SS". Darin stand nichts weiter als geschickt zusammengestelltes, altbekanntes Material, doch daß ein Magazin dermaßen auf den kommerziellen Erfolg eines solchen Titels spekulieren konnte, führt uns zu den ethischen Fragen, die durch "Les Bienveillantes" aufgeworfen werden.
Ethik also. Ein großes Wort, aber wie soll man sonst über die bloß voyeuristischen Impulse reden, die die Leser in Massen dazu getrieben haben, sich das neunhundert Seiten lang schwadronierende Monster genau zu betrachten? Wie soll man von einem Autor reden, der die Beschreibung von Greueltaten nur so hervorgurgelt, gefangen in einer morbiden und ungesunden Faszination, bis das Buch seine monströse Dimension erreicht und sich daran berauscht, alle militärischen Ränge und Begriffe auf deutsch zu bringen, so daß im Anhang ein Militärglossar angefügt werden muß, das deutsche und französische Begriffe gegenüberstellt.
Das Ganze hat etwas Spätpubertierendes. Wie sonst soll man den ethisch nicht zu verteidigenden Entschluß bewerten, über eine derart lange Strecke den Monolog eines Henkers wiederzugeben, ohne den kleinsten Raum für Autor oder Leser zu lassen? Man braucht sich nur mal anzusehen, wie Jean Hatzfeld dieses Problem jüngst bei der Beschreibung des Genozids in Ruanda gelöst hat, um die literarische Winzigkeit von Littell zu begreifen.
Doch dieser Winzigkeit steht ein riesiger Erfolg gegenüber, zu dem auch einiges bemerkt werden muß. Wenn dieses Buch schon kein neues Kapitel der Literatur eröffnet, so markiert es doch eine neue Epoche in der französischen Verlagsgeschichte. Zum ersten Mal wurde hier ein Roman auf amerikanische Art behandelt: mit Agent, einem entsprechenden Vorschuß - was in Frankreich bislang äußerst selten war - und einer entsprechenden Plazierung in den Buchhandlungen, noch bevor klar war, ob das Buch überhaupt ein Erfolg sein würde. Daß überhaupt ein Erstlingsroman von neunhundert Seiten verlegt wird, ist unerhört - und so ganz stimmt es ja nicht: Littell hat bereits Ende der 80er Jahre in England einen Science-fiction-Roman veröffentlicht, den er aus seinem Lebenslauf getilgt zu haben scheint.
Es ist schon eine besondere Ironie, daß ausgerechnet der traditionsbewußteste französische Verlag sich dazu entschlossen hat, mit diesem Monsterbuch eine ohnehin von allen erwartete Revolution anzuzetteln. Das ist die einzig gute Nachricht, die von "Les Bienveillantes" ausgeht: Wenn nun mehr Agenten in der französischen Literaturszene wirken, so bedeutet das auch eine Verringerung der Bücherlawine jeder Rentrée und eine bessere Bezahlung der Autoren. Angesichts der umfassenden Korruption des Literaturbetriebs ist damit zu rechnen, daß Littell in diesem Jahr neben dem Verkaufserfolg auch noch den Prix Goncourt genießen darf. Das wäre zwar nicht gerade zum Ruhme der Goncourt-Jury, aber da kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an.
Der Autor ist Chefredakteur des französischen Kulturmagazins "Les Inrockuptibles".
Aus dem Französischen von Nils Minkmar
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main