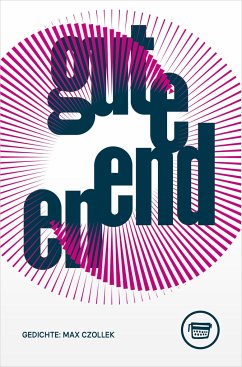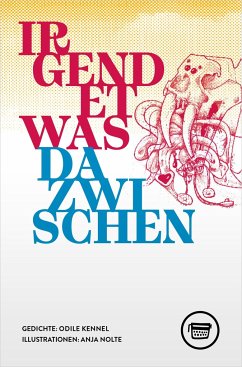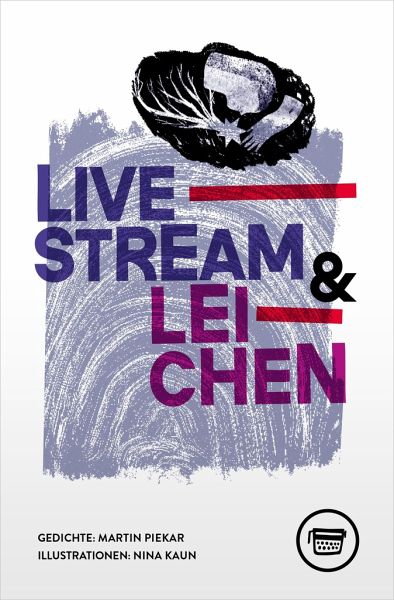
Livestream & Leichen
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
22,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Was als Spaziergang beginnt, entpuppt sich bald als Tour de Force, als Streitgespräch mit Bots, Bekannten, Liebhaber_innen - vor allem Leichen. Wie ein Chor aus griechischen Tragödien fordern die Toten genauso wie der lebendige digitale Livestream immer wieder das Gespräch und mit der Vergangenheit und mit der Gegenwart. In digitalen Räumen, unter Bettdecken und in Krankenhäusern: Überall fragen die Leichen, wie die Zukunft zu gestalten ist, wenn wir uns gemeinschaftlich der Realität versperren. Piekars Schreiben ist eine Einladung, mit ihm zu gehen, zu schreiten, zu rennen und innezuha...
Was als Spaziergang beginnt, entpuppt sich bald als Tour de Force, als Streitgespräch mit Bots, Bekannten, Liebhaber_innen - vor allem Leichen. Wie ein Chor aus griechischen Tragödien fordern die Toten genauso wie der lebendige digitale Livestream immer wieder das Gespräch und mit der Vergangenheit und mit der Gegenwart. In digitalen Räumen, unter Bettdecken und in Krankenhäusern: Überall fragen die Leichen, wie die Zukunft zu gestalten ist, wenn wir uns gemeinschaftlich der Realität versperren. Piekars Schreiben ist eine Einladung, mit ihm zu gehen, zu schreiten, zu rennen und innezuhalten: auf Parkbänken, unter Brücken und Verkehrsinseln.