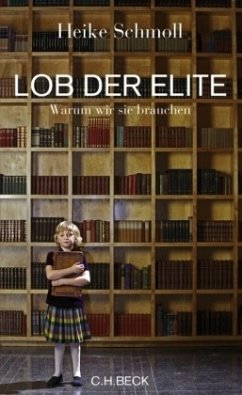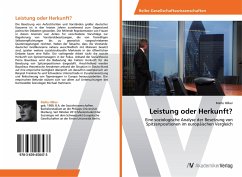Der Begriff "Elite" wird neuerdings wieder ganz unbefangen gebraucht, vor allem im Zusammenhang mit den neuen Elitehochschulen. Doch lassen sich Eliten schaffen? Und ist dies in einer Demokratie überhaupt wünschenswert? Heike Schmoll nimmt in ihrem fulminanten Lob der Elite die ewigen Elite-Kritiker ebenso aufs Korn wie die Wissenschafts-Planer, die eine Elite am Reißbrett schaffen wollen. Mit Blick auf die Geschichte von Eliten und ihre Bildung zeigt sie, warum wir nicht auf Eliten verzichten können und wie diese beschaffen sein müssen.
In keinem der führenden Industrieländer sitzt die Abneigung gegen Eliten so tief wie in Deutschland. Für Franzosen gehört die gezielte Rekrutierung der Eliten in Wissenschaft, Gesellschaft, Politik und Wirtschaft ganz selbstverständlich zu den staatspolitischen Pflichten der Republik. Denn Eliten sind für keine Staatsform so unentbehrlich wie für die Demokratie. Deshalb muß der Zugang zur Elite prinzipiell offen, die Auswahlmethode transparent sein. Sobald sich Eliten abschotten, ihre Vorrechte genießen und für sich behalten wollen, verfehlen sie ihren gesellschaftlichen Auftrag. Da weder Tradition und Herkunft noch Bildung oder Leistungsstärke allein für die Zugehörigkeit zur Elite bürgen, müssen Weitsicht, Verantwortungs- und Pflichtbewußtsein, aber auch der Mut zum Alleingang hinzukommen. Heike Schmoll zeigt, wie Eliteförderung und Persönlichkeitsbildung miteinander verbunden werden können, damit Deutschland die Eliten bekommt, die es braucht.
In keinem der führenden Industrieländer sitzt die Abneigung gegen Eliten so tief wie in Deutschland. Für Franzosen gehört die gezielte Rekrutierung der Eliten in Wissenschaft, Gesellschaft, Politik und Wirtschaft ganz selbstverständlich zu den staatspolitischen Pflichten der Republik. Denn Eliten sind für keine Staatsform so unentbehrlich wie für die Demokratie. Deshalb muß der Zugang zur Elite prinzipiell offen, die Auswahlmethode transparent sein. Sobald sich Eliten abschotten, ihre Vorrechte genießen und für sich behalten wollen, verfehlen sie ihren gesellschaftlichen Auftrag. Da weder Tradition und Herkunft noch Bildung oder Leistungsstärke allein für die Zugehörigkeit zur Elite bürgen, müssen Weitsicht, Verantwortungs- und Pflichtbewußtsein, aber auch der Mut zum Alleingang hinzukommen. Heike Schmoll zeigt, wie Eliteförderung und Persönlichkeitsbildung miteinander verbunden werden können, damit Deutschland die Eliten bekommt, die es braucht.

F.A.Z.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Der eigentlichen Frage, nämlich der nach den Bedingungen einer demokratischen und daher lobenswerten Elite, geht Heike Schmoll in ihrer kulturkonservativen Abhandlung eher aus dem Weg, findet Ruth Führer. Sie stimmt zwar mit Schmoll überein, dass es in einer offenen Gesellschaft "mehrere prinzipiell gleichberechtigte Eliten ohne politischen Herrschaftsanspruch" geben sollte, wie die Autorin zitiert wird, aber warum setzt Schmoll ihr an sich gutes Argument dann nicht durch, fragt sich die Rezensentin. Stattdessen schiebt sie das Versagen einer pluralen Elitebildung und ihrer Akzeptanz einseitig der Bildungsmisere in die Schuhe und blendet die wirtschaftlichen Machtfaktoren, die durch "zirkuläre Selbstrekrutierung" entstehen, aus. Auf ihrem Gebiet der Bildungsforschung ist Schmoll dann aber wieder auf diskursiver Höhe: Sie sieht in der G8-Reform schädliches Nützlichkeitsdenken am Werk und entlarvt die Exzellenzinitiative als universitäre Mogelpackung, so die Rezensentin.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH