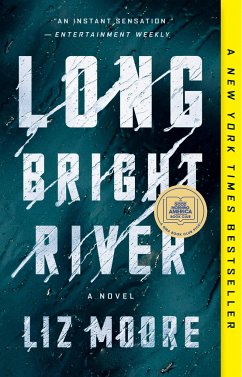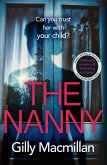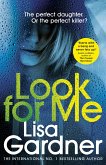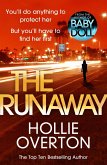Two sisters who could hardly differ more. Mickey has always been the serious, more diligent one who went to school eagerly and was dreaming of a better life than the one they had at their not very loving grandmother’s. Kacey, eighteen months her junior, has always been the wilder, more adventurous
girl who early pushed against the boundaries. Now, as grown-ups, they find themselves on opposing…mehrTwo sisters who could hardly differ more. Mickey has always been the serious, more diligent one who went to school eagerly and was dreaming of a better life than the one they had at their not very loving grandmother’s. Kacey, eighteen months her junior, has always been the wilder, more adventurous girl who early pushed against the boundaries. Now, as grown-ups, they find themselves on opposing sides: Mickey has become a cop with the Philadelphia police, Kacey is highly addicted and working on the street. Mickey always has an eye on her younger sister even though they haven’t been talking for years. When several young and vulnerable women are killed, Mickey is highly alarmed since she hasn’t seen Kacey for several weeks.
Liz Moore‘s novel is a brilliant combination of a mystery novel with the search for a serial killer and a very sad story about a dysfunctional family where problems are handed from one generation to the next and where an escape is not really possible not matter how hard you try. Even though it looks as if there were clear sides, the good sister Mickey and the bad sister Kacey, you realise soon that life isn‘t that easy and that both women are more like different and changing shades of grey.
Mickey is a great protagonist in so far as she has a lot of interesting traits to offer. On the one hand, she is the hard working single mom who only wants the best for her son and constantly fears that she cannot live up to her own expectations. As a policewoman, too, she seems to do a great job, her family history helping her to understand the situation of the less favoured by life and those on the streets. That she suffers from constant misogyny in the forces does not really astonish. Yet, there are also other sides of the young women which only slowly unfold and show that there are a lot of lies she has been told by the people around her, but also lies that she told herself to shape the things in the way she wants to see them.
The mystery parts about the serial killer and the search for the sister are full of suspense and have some unexpected twists and turns to offer. What struck me most was the feeling that a lot of what Moore narrates is actually very sad, none of the characters has much to look forward to in their life and all seems but too authentic. A novel which provides entertainment but also much to ponder about after the last page thus something not to be missed.