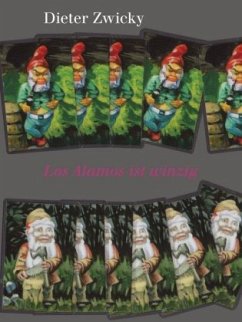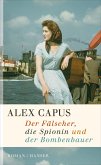Ein schmaler Steg führt hinein in dieses Los Alamos. Mit jedem Satz zeigt es etwas mehr von sich. Es ist belebt von Geschöpfen und Gewächsen, die wir von ferne kennen. Zuerst Jacqueline und der Erzähler: Das Paar sitzt auf seiner Terrasse und versucht, sich einen Überblick zu verschaffen, umringt von zugewandten Orten aller Art, mit Karrieren, so abschüssig, wie nur das Wüstenleben sie schreibt. Dieses Figurenensemble, wie hergeweht, bildet einen flimmernden Kreis. Man erzählt sich sein je eigenes Los Alamos oder fantasiert es sich entzwei. Einige hoch bemerkenswerte Vorkommnisse sind zu verzeichnen: Kurze Chardonnay-Euphorien im Abendwind, die Landung eines Nuntius im Fesselballon, gefolgt von Reminiszenzen an eine stramme Kindheit in Liechtenstein. Und über allem: Los Alamos. Seine Himmel, seine Hunde, seine Menschen. Ein atmosphärisches Kollektiv, das zu gleichen Teilen lebt und im Erzählen aus sich heraus entsteht. Zwickys Sätze sind Ereignisse, seine Assoziationen Abenteuerreisen. Er lässt die Sprache wetterleuchten über einer Stadt, zu der nur ein Weg führt: Lesen und Wiederlesen.Michel Mettler
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Paul Jandl kann natürlich nichts über Los Alamos in New Mexico sagen, aber Los Alamos in Dieter Zwickys Roman findet er super. Schon die Leute, die da Leben: die sportliche Gretchen Behausnig mit ihrem Tasmanien-Spleen, den Dichter Bruce Litchener mit seinem protogenuesischen "Funkerlatein", den Erzähler mit seiner "nervotischen" Grundstimmung und seine Jacqueline. Aber eigentlich ist Jandl vom ganzen Setting hingerissen, von Zwickys kuriosen Volten, von der anarchischen Komik und überhaupt der "radioaktiven Poesie". Ein großer Roman über eine winzige Stadt, meint er.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH