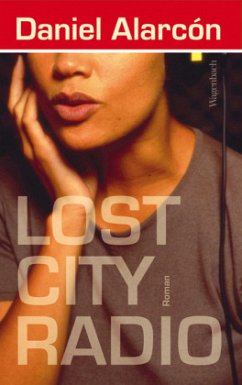Eine Frau, deren Stimme einem verwüsteten Land die Hoffnung zurückgibt, ein Kind ohne Eltern und die Geschichte einer entzweiten Liebe - Lost City Radio ist das großartige, universelle Portrait eines Landes zwischen Repression und Bürgerkrieg.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Schreiben über das Unbeschreibliche: Drei junge amerikanische Autoren und ihre Bücher über den globalen Schrecken
Schweigen ist die Antwort. Schweigen, Verschweigen und Vergessen. Nach der Rückkehr aus der Welt, nach der Rückkehr aus dem Krieg, dem Wahnsinn, dem Töten ringsumher. Wer in der Hölle war, will vergessen und sonst nichts. "Ich schloss die Augen und versuchte, alle Bilder von diesem Zimmer aus meinem Gedächtnis zu löschen. Ich wollte mich später nicht daran erinnern. Ich wollte nie wieder hierher zurückkommen." Nie wieder. Wie erzählt die Literatur der Gegenwart vom Krieg? Wie vom Terror, von der Angst? Wie erzählen, wenn Täter und Opfer schweigen und vergessen wollen? "Der Ennui des Flaneurs des 19. Jahrhunderts hat sich in die politische Apathie des Bürgers des 21. Jahrhunderts verwandelt", hat die englische Autorin Zadie Smith gerade in einem Text über realistische Literatur der Gegenwart im "New York Review of Books" geschrieben. Aber stimmt das überhaupt?
In diesem Herbst sind auf Deutsch drei Bücher junger amerikanischer Autoren erschienen, zwei Romane und ein Erzählungsband, die auf unterschiedliche Weise dieser Apathie begegnen. Auf unterschiedliche Weise Formen des engagierten Schreibens erproben, dem man in unserer Gegenwart kaum noch begegnet. Matthew Eck, 34, war Mitte der neunziger Jahre Soldat der US-Army auf Haiti und in Somalia. Er brauchte Geld fürs College und Stoff für seine Bücher, also ging er zur Armee. Daniel Alarcón, 31, wurde in Lima geboren. Als er drei Jahre alt war, verschwand sein Onkel, wie viele tausend andere Menschen damals in Peru. Er floh mit seiner Familie in die Vereinigten Staaten. Später kehrte er für ein Jahr allein zurück, auf der Suche nach dem Leben, das er dort nicht gelebt hatte. Nam Le, 30, war noch ein Säugling, als er mit seiner Familie auf einem Boot von Vietnam nach Australien floh. Er arbeitete später als Anwalt in Melbourne. Schon seine juristische Abschlussarbeit an der Universität hatte er in gereimten Versen abgegeben. Er blieb nicht lange Anwalt, reiste um die Welt, schrieb einen 700-Seiten-Roman, studierte in Iowa Creative Writing, warf den Roman weg und begann Geschichten zu schreiben.
Allein unter Feinden
Die Bücher der drei Debütanten handeln vom Krieg und vom Vergessen in den unterschiedlichsten Gegenden der Welt. Sie versuchen das Unerzählbare zu erzählen. Das Zitat oben, am Anfang des Textes, stammt aus dem Roman von Matthew Eck, dem Soldaten auf der Suche nach dem Erzählstoff. Er hat in Somalia mehr als genug davon gefunden. Sein Buch heißt auf Deutsch "Das entfernte Ufer", und der Moment, in dem der Ich-Erzähler die Augen schließt, um schon im Augenblick des Erlebens das Vergessen zu üben, steht etwa in der Mitte des Buches. Es erzählt die Geschichte von sechs GIs, sie sind Späher auf dem Dach des höchsten Hauses in einer namenlosen Stadt, wahrscheinlich Mogadischu, sie geben Anweisungen an die amerikanischen Bomber, die ihre Angriffe auf die Stadt fliegen, in der irgendwo Kriegsherren wohnen. Sie haben die ganze Stadt im Blick, auch in der Nacht, "die armen Seelen da unten, diese armen Schweine hatten keine Ahnung, dass wir sie vom Dach des höchsten Gebäudes der Stadt beobachteten". Sie selbst sind die Herren des Krieges in diesem Moment. Doch etwas geht schief. Auf dem Weg hinunter vom Dach erschießen sie in der Dunkelheit zwei unbewaffnete Jungen, ihr Wagen wird gestohlen. Später fällt auch noch ihr Funkgerät aus. Sie sind von ihrer Truppe getrennt, allein auf sich gestellt in einem Land, von dem sie nichts wissen, dessen Landessprache sie nicht sprechen. Und die Kriegsherren vom Dach sind plötzlich die Gejagten, denn der Mord an den Jungen spricht sich in Windeseile herum. Die ganze Stadt jagt sie.
Eck erzählt das alles knapp und klar, atemlos und zwingend. Es ist eine Geschichte jenseits der Nachrichtenwirklichkeit, aus der Zeit, als damals, für einen kurzen Moment, die Nachrichtenbilder aus einem fernen "Friedenskonflikt" der Medienmacht entglitten waren und plötzlich ein amerikanischer Soldat vor den Augen der Welt vom somalischen Mob durch die Straßen Mogadischus gezerrt wurde. Die Nation war geschockt damals, dabei war das einfach nur: der Krieg, jenseits von Zinksärgen unter Landesfahnen und namenlosen Bombenopfern in unbekannten Gegenden der Welt. Eck erzählt von diesem Krieg. Verlorener als diese amerikanischen Soldaten kann man kaum sein. Allein unter Millionen Feinden, die Munition geht aus, die Nahrung geht aus, die Orientierung haben sie längst schon verloren. Sie wissen nicht, wie sie da jemals wieder rauskommen. Und vor allem wissen sie auch nicht, warum sie jemals da hineingekommen sind, was eigentlich das Ziel ihres Einsatzes war. "Ist den Amerikanern eigentlich klar, dass wir kein Öl haben?", fragt sie der einzige Mensch, dem sie begegnen, der ihre Landessprache spricht. Sie wissen nichts, sind auf nichts vorbereitet, kämpfen, und sonst nichts: "Ich holte die Karteikarte mit den Regeln für unseren Einsatz heraus, die in meinem Helm steckte. Ich wollte noch einmal nachlesen, was dort über das Töten von Kindern stand."
Nein, das ist kein Witz. Das ist das atemberaubende Bild für die Situation eines jungen Kämpfers, der die Erlösung von einer schrecklichen Schuld auf der kleinen Ratschlagtafel eines unbekannten hohen Einsatzleiters sucht. Doch die Karte ist leer, es gibt keine Erlösung, die Armee hat sie im Nichts zurückgelassen, allein, ohne Auftrag, ohne Ziel. Der Soldat überlebt, etwas von ihm überlebt das alles, aber der Moment der geschlossenen Augen soll bis an sein Lebensende dauern: "Als ich zum Sanitätszelt zurückging, dachte ich an die Jahre auf dem College, die vor mir lagen. Ich würde niemandem erzählen, dass ich in der Army gewesen war. Und wenn sie mich fragten, warum ich etwas älter war, würde ich sagen, ich hätte eine Weile in Europa gelebt, vielleicht in Prag." Die erhoffte Amnesie des Einzelnen ist die Amnesie des ganzen kriegführenden Landes. Durch Verschweigen hofft man diese dunklen Seiten für immer ungeschehen zu machen.
"Das Land versuchte nun, zu vergessen, dass es je einen Krieg gegeben hatte." Das Land, von dem hier die Rede ist, liegt in Südamerika, es ist der Schauplatz des Romans "Lost City Radio" von Daniel Alarcón. Es trägt viele Züge seines Geburtslandes Peru, aber es hätte so auch in anderen südamerikanischen Ländern unter einer Militärdiktatur geschehen können. Alarcóns Roman ist in weiten Teilen das Gegenteil des Kriegsbuchs von Eck. Es ist poetisch, verträumt, romantisch und verschachtelt - einfach sehr südamerikanisch im Gegensatz zu Ecks knallharter Realitätsprosa. Es ist eine Liebesgeschichte und die Geschichte eines Verschwindens. Es ist die Geschichte von Norma, die in einem Land, in dem Menschen massenhaft einfach so verschwinden, eine Radiosendung moderiert, in der Angehörige ihre verschwundenen Familienmitglieder suchen lassen können. Es ist die erfolgreichste Sendung des Landes, in jedem Dschungeldorf versammeln sich die Menschen um den Radioapparat und hören zu. Norma ist die Stimme des Landes, die Stimme der Hoffnung. Das Kunststück der Sendung: Der Bürgerkrieg darf nicht erwähnt werden, nicht einmal das Wort Krieg, und Verschwundene, die offiziell als Rebellen gelten, auch nicht. Wer in diesem Land einmal als Aufständischer galt, wird sogar aus dem Geburtsregister gestrichen. Es ist, als habe es ihn nie gegeben: "Menschen verschwanden, sie lösten sich auf. Und mit ihnen ihre Geschichte, so dass neue Mythen die alten ersetzten." Es ist ein Land ohne Vergangenheit, ein sonderbarer Planet. Die alten Sprachen wurden verboten, die alten Dörfer dürfen ihre alten Namen nicht mehr tragen und wurden einfach durchnumeriert. Norma ist die Verbindung in die mythische Vergangenheit, das Dunkle, Unaussprechliche, für das sie eine neue Sprache finden muss. Und auch Norma ist auf der Suche. Ihr Mann Rey ist verschwunden, vor mehr als zehn Jahren: "Keine Nachricht, kein Wort, und Normas Leben änderte sich mit jedem Tag, der vergeht, plattgedrückt unter einem zerschmetternden Gewicht, farblos ausgeblutet."
Der Mond des Grauens
Schon früher war er immer mal wieder verschwunden. Mal in den Dschungel, er ist Professor für Botanik, und man weiß nie, wie lange seine Forschungsreisen dauern, mal im Auftrag der Widerstandsgruppe IL, mal, weil er von den Militärs in ein Umerziehungslager verschleppt wurde. Auf den "Mond", so heißt dieser abgeschiedene Ort des Schreckens, von dem jeder Bewohner des Landes weiß, aber über den niemand spricht. Der Mond ist das leere Zentrum des Buches, das leere Zentrum des Landes. Wer einmal hier war, verliert die Fähigkeit über das Wichtigste zu sprechen. Das Leben danach ist nur noch ein Verschweigen, ein Leben in Angst, ohne Worte: ",Du möchtest nichts erzählen, oder?', fragte Norma. ,Nein', sagte er und war selber überrascht. Es gab zu viel zu erzählen." Alarcóns Kunststück ist es, diesem Umschreiben des großen Schweigens eine wunderbare Geschichte voller Sehnsucht, Angst, Engagement, Verzagtheit und Kampfeslust abzutrotzen, das Schweigen zu besiegen - mit seiner Geschichte.
Auch die Geschichten von Nam Le verschweigen viel und erzählen alles. Auch in vielen seiner Geschichten steht etwas Unaussprechliches im Mittelpunkt. Wenn er von Vietnam erzählt, ist es meist auch ein sogenanntes Umerziehungslager, das am Anfang des Schweigens steht. Aber Nam Le schreibt nicht nur über sein Geburtsland Vietnam, die Erzählungen seines Debütbandes spielen in der ganzen Welt, es ist eine Art Erzählungsband des globalisierten Schreckens. Nam Le erzählt von einem Auftragskiller in Medellin, von den Minuten, bevor in Hiroshima die Atombombe fällt, von zwei Frauen in Teheran nach der Revolution - so aufgelistet liest sich das wie ein etwas absurder, aufgesetzter Wille zur Schrecklichkeit, einem Willen zur geliehenen Weltdramatik, wo die eigene erzählerische Kraft zu einer Geschichtsdramatik nicht ausreicht. Und so ganz lässt sich der Verdacht nach Lektüre aller Schreckensgeschichten auch nicht von der Hand weisen. Nam Le leiht sich Schrecklichkeiten, wo er sie findet, aber die Geschichtsereignisse bilden nur den Rahmen seines psychologischen Erzählens. Le ist ein Seelenkenner, ein Mann, der sich in Menschen in Extremsituationen einfühlen, eindenken kann, und das gerade ohne in diesen Momenten zu viel Drama in die Menschen hineinzudenken. Er erzählt von diesen Orten, von diesem Horror der Welt und zeichnet die inneren Erlebnisse der Täter und Opfer mit unglaublich zartem, feinem Strich nach. Nur wenn er manchmal die Natur, die Gebäude, die äußeren Umstände der Welt allzu symbolisch für die Beschreibung des Seelenzustands seiner Protagonisten missbraucht, wird es etwas unangenehm.
Die erste Geschichte des Bandes handelt von einem jungen Mann - der heißt Nam Le, kam als Säugling als Bootsflüchtling aus Vietnam, lernt nun in Iowa in einem Creative-Writing-Kurs das literarische Schreiben - und hat eine Schreibblockade. Nein, schreit man schon! Bachmannpreis-Ich-Prosa-Quatsch jetzt schon in Amerika! Aber wie er sich aus diesem Selbstbezüglichkeitshorror in der Geschichte wieder herauswindet, sich schließlich gegen alle inneren Widerstände entschließt, "Scheiß drauf!", eine von ihm eigentlich gehasste "Ethno-Story" über seinen vietnamesischen Vater zu schreiben, und wie er sie also schreibt, mit aller Wucht der Wahrheit und dem Willen, das Familienschweigen zu brechen, das ist dann schon wieder ganz große Amerika-Kunst. Ebenso weit entfernt vom Ennui des 19. wie von der politischen Apathie des 21. Jahrhunderts.
VOLKER WEIDERMANN
Matthew Eck: "Das entfernte Ufer". Übersetzt von Bettina Abarbanell. Tropen-Verlag, 188 Seiten, 18,90 Euro. Daniel Alarcón: "Lost City Radio". Übersetzt von Friederike Meltendorf. Wagenbach, 314 Seiten, 22,90 Euro. Nam Le: "Im Boot". Übersetzt von Sky Nonhoff. Claassen-Verlag, 332 Seiten, 22 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Angetan zeigt sich Kersten Knipp von Daniel Alarcons Buch "Lost City Radio", das er als ebenso "spannenden" wie "bewegenden" Roman lobt. Im Zentrum der in einer anonymen lateinamerikanischen Diktatur spielenden Geschichte sieht er die Radiomoderatorin Norma. Über ihre Sendung versucht sie, verschwundene oder in den Wirren des Bürgerkriegs voneinander getrennte Menschen und besonders ihren ehemaligen Lebensgefährten Rey wieder zu finden. Alarcon gelingt es nach Ansicht Knipps, das Leben nach dem Bürgerkrieg in einer Zeit der totalen Kontrolle fesselnd darzustellen. Dabei attestiert er ihm, dem Leser auch jenseits "persönlicher Geschicke" die Augen für die "Mechanismen totalitärer Herrschaft" zu öffnen. Vergleiche mit den Werken eines Alejo Carpentier, Augusto Roa Bastos oder Miguel Angel Asturias scheinen Knipp daher durchaus angebracht.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH