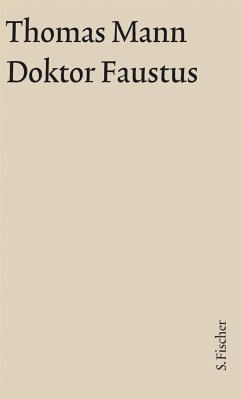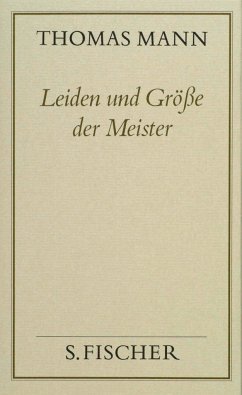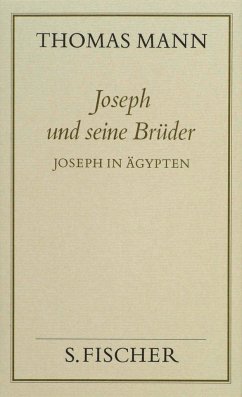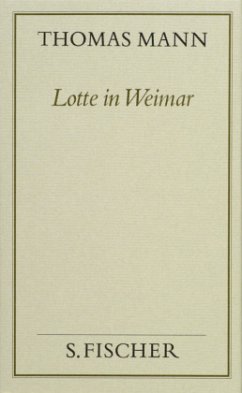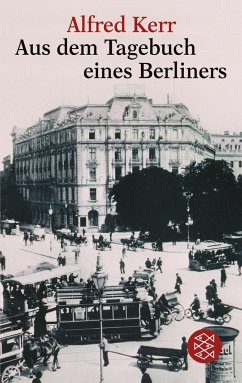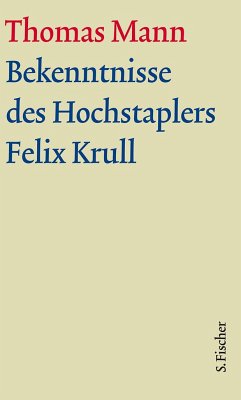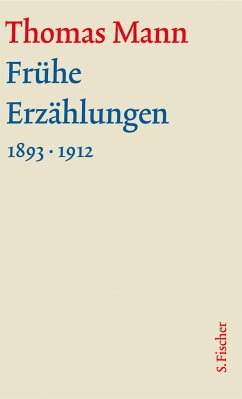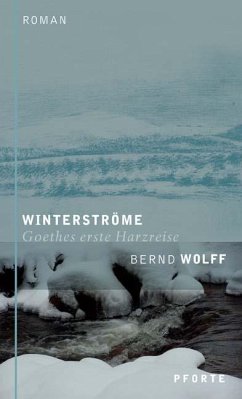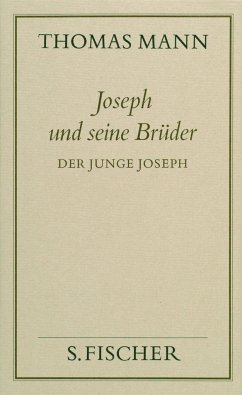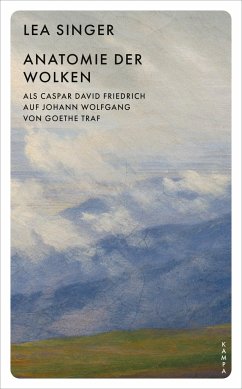Lotte in Weimar. Große kommentierte Frankfurter Ausgabe. Textband

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Grundlage für Thomas Manns Goethe-Roman ist der historisch verbürgte Besuch Charlotte Kestners Goethes Jugendliebe und Vorbild für die Figur der Lotte im »Werther« 1816 in Weimar. 1939 ist der Roman unter schwierigen Bedingungen im Exil veröffentlicht worden. Im Rahmen der »Großen kommentierten Frankfurter Ausgabe« wird »Lotte in Weimar« zum ersten Mal nach der Handschrift ediert und damit von zahlreichen Lese- und Druckfehlern bereinigt. Der Kommentar erschließt das Werk von Grund auf in seiner komplexen philologischen und quellengeschichtlichen Struktur und wird so zum hilfreiche...
Grundlage für Thomas Manns Goethe-Roman ist der historisch verbürgte Besuch Charlotte Kestners Goethes Jugendliebe und Vorbild für die Figur der Lotte im »Werther« 1816 in Weimar. 1939 ist der Roman unter schwierigen Bedingungen im Exil veröffentlicht worden. Im Rahmen der »Großen kommentierten Frankfurter Ausgabe« wird »Lotte in Weimar« zum ersten Mal nach der Handschrift ediert und damit von zahlreichen Lese- und Druckfehlern bereinigt. Der Kommentar erschließt das Werk von Grund auf in seiner komplexen philologischen und quellengeschichtlichen Struktur und wird so zum hilfreichen Wegweiser durch diesen Roman.