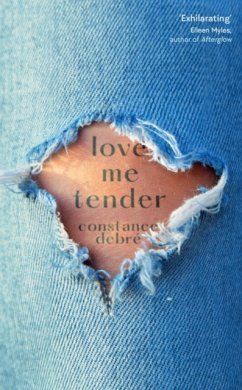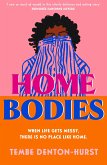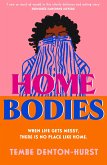Schonungslose Autofiktion: Constance Debrés drastische Selbstbespiegelung in "Love Me Tender"
Es gibt eine Vorstellung von Literatur als radikaler Grenzüberschreitung, als enthemmtem Exzess. Dass dieser Avantgardismus nicht irgendwann Ende der Sechziger still ausgestorben ist, sondern sich großer Vitalität erfreut, belegt Constance Debré mit "Love Me Tender". Ihr nicht ganz treffend als "Roman" bezeichneter Text ist im Bereich der Autofiktion angesiedelt und stellt ein asketisches Gegenstück zu Pierre Guyotat dar: Das Reduzieren aufs Elementarste, das Ausloten des existenziell-ästhetisch Machbaren - ein kompromissloser Job, der wohl getan werden muss, für die Literatur und ihre Geschichte. Und nebenbei enormen Erfolg bei Kritikern und Publikum hat.
Debrés Erzählerin, die der Autorin verdächtig ähnelt, berichtet, wie ihr Leben zerbröselt. Am Anfang steht der Beschluss, den Anwaltsberuf aufzugeben und sich dem Schreiben zu widmen, gekoppelt mit dem Coming-Out als Lesbe. Ihr Noch-Ehemann Laurent erweist sich als uneinsichtiger Rächer, der ihr den gemeinsamen Sohn Paul abspenstig macht, indem er sie des Inzests und der Pädophilie anklagt und den Umgang mit dem Achtjährigen sabotiert. Die mühselig mahlenden Mühlen der französischen Justiz sind seine unfreiwilligen Helfer, ebenso gutmeinende Mitarbeiterinnen einer Begegnungsstätte, die glauben, einer zerrütteten Familie mit Minibesuchen unter Aufsicht zu helfen.
Dieser Hälfte von "Love Me Tender" steht das Intimleben der Erzählerin gegenüber. Wut und Verzweiflung treiben sie in immer größere Extreme. Einerseits fährt sie ihre materielle Existenz auf ein Minimum herunter: "Dass ich blank bin, verleiht allem klare Konturen. Neun Quadratmeter, zwei Jeans, drei T-Shirts, die alte Jacke und meine alte Rolex, nur aus Jux, ein Kaffee am Tresen, ein Baguette, eine Schachtel Zigaretten, meine Schwimmbadkarte. Die Welt wird zu einem Körper ohne Fett." Sie wohnt in schrumpfenden Behausungen, schläft schließlich bei Freunden und Bekannten, isst, was sie bekommt, klaut in Supermärkten. Die Obdachlosenexistenz ruft, nur das tägliche Schwimmen ist ein Rückgrat: Sie ist "ein einsamer Cowboy".
Andererseits hat sie Sex: "Frauen, Frauen und noch mehr Frauen. Ich erhöhe die Dosis, denn die Wirkung lässt nach. Eine blonde Bullette, kurze Haare, sexy, die Marke am Gürtel, eine Knarre, sie mustert mich, ich sie, wir reden, sie ist im Dienst, ich gebe ihr meine Nummer. Ein Mädchen auf einem Motorrad, ich rufe ihr etwas zu, als ich vor ihr die Straße überquere, sie parkt ihr Motorrad und schließt sich mir an. Eine Schmetterling-Schwimmerin mit perfektem Körper, der ich am Ende der Bahnen Komplimente mache, wir treffen uns in der Umkleide." Für Sentimentalitäten ist kein Raum: "Hurensohn, steht auf meinem Bauch, wer mit mir ins Bett geht, hat das gelesen, das sind die Geschäftsbedingungen, Schätzchen."
Debrés Roman erzeugt einen faszinierenden Sog. Dabei übersieht man leicht die Ambivalenzen, die ihn durchziehen. Einerseits vögelt sich die Erzählerin durchs Leben, andererseits vertritt sie die absolute Liebe: "Liebe braucht nicht mal Gegenliebe, verlangt nichts, Liebe weiß, was sie ist, und zweifelt nie" - eine absurd romantische Vorstellung. Zum einen geht sie an der Trennung von Paul fast zugrunde, zum anderen ist Mutterschaft ihr ein Graus: "Wer möchte schon Mutter sein? Außer Leuten, die alles falsch gemacht haben im Leben." Man weiß nicht recht, ob sie es sich nur einredet, wenn sie behauptet: "Es ist anstrengend, aber auch erholsam, kein Haus zu haben, keine Familie, keine Liebe, kein Geld. Ich hätte es nie begriffen, wäre Paul bei mir gewesen."
Dass Debré sich nicht einfach mit ihrer Erzählerin identifiziert, legen reflexive Schleifen nahe: Eine Geliebte haut ihr um die Ohren, wie strapaziös ihr Pendeln zwischen den Extremen und wie anstrengend die Heldin selbst sei. Zudem verleiht Debré der Bipolarität eine Herkunft: Ruhe genießt die Erzählerin einzig in Montlouis bei ihrem drogensüchtigen Vater, wie sie ist er Auswurf einer großen Familie - abermals eine autobiographische Anleihe, denn Debré ist Enkelin und Nichte von Ministern. Ihr Vater, dieser "Inbegriff der Unschuld, der dreckigen Unschuld", lässt Liebe nicht an sich heran: "Wir lieben uns aus der Ferne. Käme ich ihm zu nah, würde ich sterben. Vielleicht macht mein Sohn das Gleiche." Die Familie mütterlicherseits, die standesbewusst ihre Sprösslinge mit acht Jahren ins Internat steckte, taugt ebenso wenig als Blaupause für familiäre Nähe.
Trotz der Herleitungen und Ambivalenzen nervt dieser "Baron de Charlus im Stil von Sid Vicious" irgendwann: Debré gefällt sich im Seelenstrip, als Bürgerschreck, in der Eiswürfel-Phrase. Die leicht angestaubte Avantgarde-Gestik hat Konsequenzen, denn "Love Me Tender" verflicht Autorin und Erzählerin, Ästhetik und Ethik - mit der Hauptfigur steht und fällt der Roman. Deren selbstgesetztes Limit ist die Liebe zu ihrem Sohn: "Meine Grenze ist Paul." Dringlicher als der hundertste Fick ohne Morgen scheint dann allerdings die Frage, warum der Sohn das böse Spiel seines Vaters spielt - und ob das nicht doch (auch) an der Heldin liegt. Selbstbetrug bestimmt diesen authentizitätswütigen Text paradoxerweise zudem in der zentralen Frage, ob Freiheit in der Unterwerfung unter grausame Umstände gefunden werden kann. Auf den Leser wirkt der Wunsch, "zugleich Meister und Sklave zu sein", quälend: Es entsteht der Eindruck einer sich selbst entfremdeten Existenz, die sich einredet, das große Los gezogen zu haben. Die finale Loslösung von Paul ist entsprechend unglaubwürdig: Freiheit meint hier den Wechsel von der Verletzung zur Selbstverstümmelung. NIKLAS BENDER
Constance Debré: "Love Me Tender". Roman.
Aus dem Französischen von Max Henninger. Matthes & Seitz,
Berlin 2024.
149 S., geb.,
20,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.