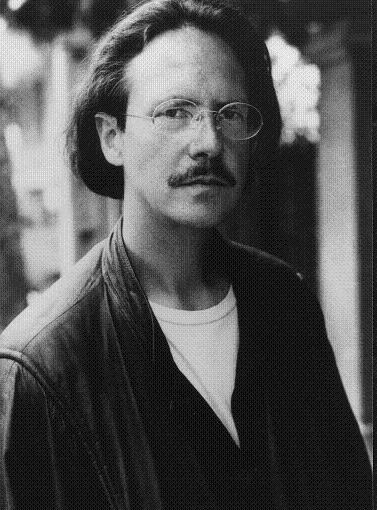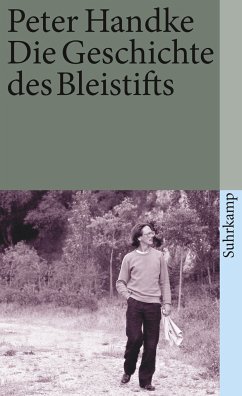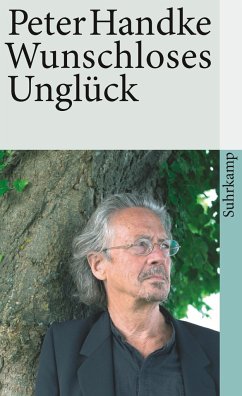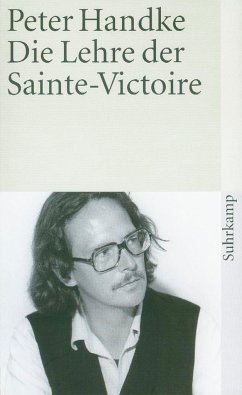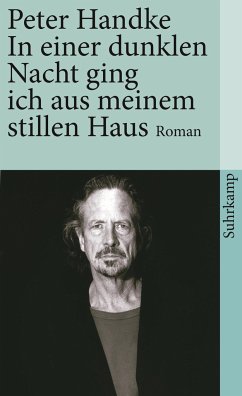Lucie im Wald mit den Dingsda
Eine Geschichte
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
11,00 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Die zehnjährige Lucie empfindet ihren Vater als eine Zumutung. Gegen die schöne Mutter, eine Kriminalpolizistin, ist der gärtnernde Vater ein lästiger »Ausfall oder Ausrutscher«. Lucie kann nur hoffen, daß »sie nicht mit dem da dort« gesehen wird, wenn er mit schmutzigen Händen und ausgebeulten Taschen, aus denen es heraustropft, vor der Schule steht, um sie abzuholen. Was da tropft, sind diese »Dingsbums« oder »Herrlichkeiten«, deretwegen der Vater immer wieder in den Wald geht, die die Mutter hingegen abschätzig »Mulms« nennt und schon lange nicht mehr essen mag. Lucie aber ...
Die zehnjährige Lucie empfindet ihren Vater als eine Zumutung. Gegen die schöne Mutter, eine Kriminalpolizistin, ist der gärtnernde Vater ein lästiger »Ausfall oder Ausrutscher«. Lucie kann nur hoffen, daß »sie nicht mit dem da dort« gesehen wird, wenn er mit schmutzigen Händen und ausgebeulten Taschen, aus denen es heraustropft, vor der Schule steht, um sie abzuholen. Was da tropft, sind diese »Dingsbums« oder »Herrlichkeiten«, deretwegen der Vater immer wieder in den Wald geht, die die Mutter hingegen abschätzig »Mulms« nennt und schon lange nicht mehr essen mag. Lucie aber kommt ab und zu - wenn auch ohne große Begeisterung - mit in den Wald, und dann findet sie sogar viele der »Wäldersattsamkeiten«, weiß die Namen der verschiedenen Arten, kennt ihre Geheimnisse. Als der Vater wegen einer angeblichen Verschwörung gegen den König verhaftet wird, macht sie sich auf, um mit Hilfe der gefundenen »Dings« in die Hauptstadt zu kommen, von den Gefängniswärtern durch- und schließlich beim König vorgelassen zu werden, den Vater zu befreien, die Familie zusammenzubringen ... Peter Handke hat eine poetische und selbstironische Geschichte geschrieben über die Fremdheit und die Liebe, über die Annäherung an die wirklichen Dinge und das Geschichtenerzählen.