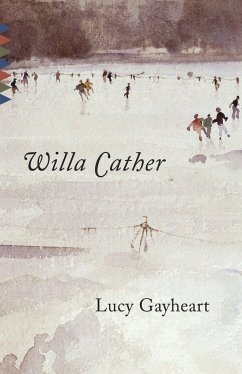In this haunting 1935 novel, the Pulitzer Prize-winning author of My Ántonia performs crystalline variations on the themes that preoccupy her greatest fiction: the impermanence of innocence, the opposition between prairie and city, provincial American values and world culture, and the grandeur, elation, and heartache that await a gifted young woman who leaves her small Nebraska town to pursue a life in art. At the age of eighteen, Lucy Gayheart heads for Chicago to study music. She is beautiful and impressionable and ardent, and these qualities attract the attention of Clement Sebastian, an aging but charismatic singer who exercises all the tragic, sinister fascination of a man who has renounced life only to turn back to seize it one last time. Out of their doomed love affair-and Lucy's fatal estrangement from her origins-Willa Cather creates a novel that is as achingly lovely as a Schubert sonata.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Berstend vor Fruchtbarkeit: Willa Cather besingt Amerika / Von Tilman Spreckelsen
Zu den amerikanischen Mythen gehört das Hohelied der Pioniere, die aus Europa kamen, ein vermeintlich herrenloses Land in Besitz nahmen und urbar machten, Schwerarbeiter und Kulturträger in einem, unbeirrbar durch Hitze, Kälte und Indianerüberfälle. So richtig literaturfähig wird das, als die Arbeit getan ist, als die Kinder und Enkel verständnislos auf die Generation der Rauhbeine starren und die Tugend der gegenseitigen Unterstützung im Farmerkollektiv einer zivilisationsbedingten Raffgier des Einzelnen gewichen ist - als also der Verlust einer Lebensform mit ihrer Überhöhung einhergeht und wunderlich romantische Blüten treibt.
Die Schriftstellerin Willa Cather, geboren 1876 in Virginia, kam als Achtjährige in den Präriestaat Nebraska, und was der anfangs zehnjährige Erzähler Jim ihres jetzt auf Deutsch wieder erschienenen Romans "Meine Antonia" dort erlebt, mag ihr so ähnlich selber widerfahren sein. Geschrieben wurde das 1918 publizierte Buch dann allerdings aus dem Abstand von dreißig Jahren, und die Sentimentalität, mit der Jim als Erwachsener nunmehr der Prärie gedenkt, ist an die Gefährtin Antonia geknüpft, die Tochter böhmischer Einwanderer, die immer noch auf dem Land lebt, während es Jim längst in die Stadt verschlagen hat. Jim erzählt von der gemeinsamen, entbehrungsreichen Jugend, wobei Antonia immer ein bisschen mehr entbehrt als er; er schwelgt in Naturbildern, in Sommern und Wintern voll harter Arbeit, nur dass er irgendwann das Feld für die Schule und die Universität verlässt, während Antonia von einem Taugenichts schwanger und danach einem braven Mann eine anständige Ehefrau wird.
Schon in der Einleitung betonen Antonias Freunde, dass diese Frau für sie rundweg "das Land" verkörpere - und überhaupt, diese Pioniere! "Was waren das doch für gute Burschen gewesen, was hatten sie alles gewusst, und wie vielen Dingen hatten sie die Treue gehalten." Einer, ein Einziger nur, bringt das Böse in diese heile Welt, derjenige nämlich, der nicht von eigener Arbeit lebt, sondern als Geldverleiher die schwer schuftenden Farmer schröpft - ihm allerdings ist dann auch ein besonders grausiges Ende beschieden, und die Dinge sind wieder im Lot. Und all die entwurzelten Europäer lernen rasch, dass sie, bei aller Not, im Land der Freien angekommen sind; einzig in bestimmten Unterwerfungsgesten, die ihnen dann doch unterlaufen, verrät sich ihre Herkunft. Ihre Kinder aber, so viel steht fest, werden das abschütteln.
Dies alles ist der Erzählung von Antonia unlösbar eingeschrieben. Was sie aber zur förmlichen Inkarnation des Mittleren Westens werden lässt, ist ihr stupender Arbeitswille, in dem sich Schwärmerei und Pragmatismus auf irritierende Weise die Hand geben, und ihr gesegneter Leib, ihre Fruchtbarkeit, die sie am Ende als Mutter einer gut zehnköpfigen Kinderschar leben lässt. Spätestens hier tut Cathers Erzähler eindeutig zu viel des Guten, indem er eine Szene breit ausmalt, die jene Engführung zwischen Land und Bauersfrau unterstreichen soll: Antonias Kinder führen den Erzähler stolz in einen Erdkeller, in dem die Feldfrüchte aufbewahrt werden, und dann drängen sie alle zusammen machtvoll wieder ans Tageslicht, "das Leben barst buchstäblich aus dem dunklen Keller ins Sonnenlicht", kommentiert der Zuschauer Jim, und "einen Augenblick machte es mich ganz schwindelig".
Man kann derlei mit der Nachwortautorin Elke Schmitter als "scheinschlichten Stil" preisen, ihre Naturschilderungen als "betörend, hochmusikalisch, scheinbar ohne Aufwand" geschrieben bewundern und Antonia dann gleich in eine Reihe mit Emma Bovary oder Anna Karenina stellen. Aber man wird auch nicht fehlgehen, wenn man es unumwunden als Schwulst einstuft und bei der Verehrung von Sonne, Mond und Scholle nicht so recht mitgehen kann.
Vielleicht wird man aber auch der Autorin nicht gerecht, wenn man die Cather-Lektüre ausgerechnet mit diesem Buch beginnt. Denn ihr großes Thema, der Aufbruch aus den kleinstädtischen Verhältnissen, hat sie in einem fünfzehn Jahre später verfassten Roman (der am 20. März bei Manesse auf deutsch erscheint) weit überzeugender durchgespielt: Der Geschichte der brauseköpfigen und dabei ihrer selbst so klar bewussten Lucy Gayheart wird man sich nicht leicht entziehen. Das Mädchen, zu musikalisch für ihre behäbige Siedlung und zu schönheitstrunken für den braven Bankierssohn, der sie heiraten will, trifft in Chicago, wo sie Klavierstunden nimmt und sich umgekehrt als Klavierlehrerin durchschlägt, den bedeutend älteren Sänger Clement Sebastian, verfällt seiner Stimme und der Vorstellung eines der Kunst gewidmeten Lebens; von da an ist sie ihrer bisherigen Welt abhandengekommen.
Natürlich geht das nicht gut aus, Cather führt die Sache mit erbarmungsloser Konsequenz zu Ende, die man in ihrem "Antonia"-Roman vermisst, ebenso wie die Distanz, die sie bei aller spürbaren Sympathie für Lucy dann doch ihrer Hauptfigur gegenüber beweist. Hier entwirft sie Miniaturen, die, sprachlich erheblich reduziert, noch lange nachwirken. Deren diskrete Effizienz mag dem Altersstil einer Autorin geschuldet sein, die sich ihrer Mittel viel sicherer ist als jene, die in "Meine Antonia" so dick aufträgt, weil sie offenbar fürchtet, dass ihr Anliegen nicht verstanden wird. Vielleicht ist es aber auch die desillusionierte Weltsicht einer Frau, die nach dem Börsenkrach und auf dem Höhepunkt der großen Depression keine Fortschrittshymnen auf Land und Leute mehr schreiben mag, sondern im letztlichen Scheitern ihrer Heldin mit leichter Hand jene gediegene Schönheit entdeckt, die sie im früheren Roman herbeizuzwingen sucht.
Willa Cather starb 1947, vielfach ausgezeichnet, in New York. Ihr einstiges Wohnhaus in Nebraska ist heute ein Museum, in der Nähe hat man ihr zu Ehren ein Stück Prärie stehen gelassen. Es fragt sich, ob man ihr auf den Straßen Chicagos nicht etwas näher kommt.
Willa Cather: "Meine Antonia". Aus dem Amerikanischen übersetzt von Stefanie Kremer. Mit einem Nachwort von Elke Schmitter. Knaus Verlag,
München 2008. 320 S., geb., 19,95 [Euro].
Willa Cather: "Lucy Gayheart". Aus dem Amerikanischen übersetzt von Elisabeth Schnack. Mit
einem Nachwort von Alexa Hennig von Lange.
Manesse Verlag, Zürich 2008. 450 S., geb., 22,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main