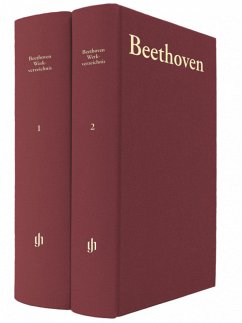Produktdetails
- Verlag: G. Henle Verlag
- Erscheinungstermin: 15. Juni 2014
- ISBN-13: 9783873281530
- Artikelnr.: 41881529
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
- Herstellerkennzeichnung Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Opus 13 "Pathétique", opus 55 "Eroica", opus 72 "Fidelio", op. 125 "Die Neunte": Wie Chiffren zum Eingang in vertraute musikalische Schatzkammern begleiten den Musikfreund nicht nur die Beinamen berühmter Kompositionen Ludwig van Beethovens, sondern auch die nüchternen Registerzahlen der Werknummern. Aber zu welchem Festsaal öffnet die symbolträchtige Ziffer 100 das Portal? Die umfassendste Antwort auf diese Frage liefert dem Wissbegierigen keine Internetsuchmaschine, sondern ein papierenes Monument (Ludwig van Beethoven. Thematisch-bibliographisches Werkverzeichnis. Bearbeitet von Kurt Dorfmüller, Norbert Gertsch und Julia Ronge. G. Henle Verlag, München 2014). "Merkenstein nächst Baden", ein Lied nach einem Gedicht von Johann Baptist Rupprecht für zwei Singstimmen und Klavier, erhielt 1816 im Erstdruck vom Verleger ohne Beethovens Wissen die bedeutungsvolle Hundert umgehängt. Deren Glanz konnte freilich nicht verhindern, dass der hübsche Zwiegesang auf ein verwunschenes Schloss voll romantischer Geheimnisse dem Vergessen anheimfiel.
Was dem Kaufmann sein Kontorbuch, das ist dem Komponisten - jedenfalls in der Retrospektive - ein wissenschaftlicher Werkkatalog. Hier wird ohne Rücksicht auf Ansehen und Bedeutung dokumentiert, was ein schöpferisches Leben lang vom Kopf durch die Feder aufs Papier gelangt ist. Im Falle Beethovens fällt die Bilanz überwältigend aus. 138 mit Opuszahl versehene Werke vom bezaubernden Augenblick einer Klavierbagatelle oder der Hübschheit eines Liedchens bis zum menschheitsumspannenden Symphonieappell führen die Habenseite an. Ohne den Opusadel schlagen sich seit langem nicht weniger als 228 Werke und teils umfangreiche Sammlungen durch die Rezeptionsgeschichte, häufig überaus erfolgreich wie die Bagatelle WoO 59 "Für Elise" oder die c-Moll-Variationen für Klavier WoO 80. Dass darüber hinaus etliche unvollendete Werke und Kompositionsstudien sowie jede Menge Hobelspäne aus der Werkstatt zu registrieren sind, mag hinter dieser gewaltigen Fülle kaum mehr von Belang erscheinen.
Doch im "LvBWV", wie der jüngste Sprössling einer inzwischen imponierend großen Familie an neueren Werkverzeichnissen von Brahms über Mendelssohn, Schumann hin zu Wagner, Wolf, Reger und Zimmermann wohl künftig im Jargon heißen wird, gilt der Eifer unbestechlich dem Ganzen. Eine kleine Forschergruppe in Bonn und München hat sich über fünfzehn Jahre hindurch in aller Strenge darauf verpflichtet, jeden musikalischen Gedanken Beethovens so zu behandeln, als stehe er unmittelbar zu Gott.
Vor sechzig Jahren war der stattliche Referenzkatalog von Georg Kinsky und Hans Halm erschienen, das Beethoven-Vademecum für die ganze Musikwelt. Sein aus besten Gründen auf über die doppelte Seitenzahl angewachsener Nachfolger zeugt nun von dem enormen Fortschritt, den die international vernetzte Musikwissenschaft seither erzielt hat. Bis in den letzten Winkel scheint das Universum des Komponisten erkundet zu sein. Die unzähligen Skizzen als Protokolle immer wieder sich verzweigender Gedankenströme, von Beethoven mit unbestechlichem Musikverstand auf die Bahn hin zum endgültigen Werk gelenkt, konnten inzwischen weitgehend identifiziert werden.
Was an autographen Quellen (vor allem infolge des Zweiten Weltkriegs) über alle Lande zerstreut war, wurde zu großen Teilen wieder lokalisiert. Für die schier unüberschaubare Landschaft der historischen Druckausgaben Beethovenscher Werke liegt eine konturenscharfe Karte vor. Die nicht selten auf Irr- und Abwegen sich vollziehende Entstehungsgeschichte vieler Werke steht hell vor unseren Augen. Wer etwa den fast sechzig Seiten umfassenden Werkartikel zu Beethovens "Fidelio" gelesen hat, der versteht, warum seine einzige Oper für den Komponisten ein Schmerzenskind war.
Ist die Beethovenforschung damit an ihrem Ziel? Wohl kaum, im Gegenteil, denn mit diesem Triumph der Musikphilologie hat sie in erster Linie neue Gewissheit über ihre Basis geschaffen. Das "LvBWV" zieht sichere Grenzen hin zum Nichtwissen und zum Fehlerhaften. Für unrichtige Angaben zu Leben und Werk Beethovens gibt es nun kaum mehr eine Entschuldigung. Schwere Zeiten für Bequemlichkeit und Schlamperei! Aber über diesen fulminanten, kaum hoch genug zu preisenden Beitrag zur Grundlagensicherung hinaus bieten die Katalogbände noch eine heimliche Biographie Beethovens von bislang unbekannter Genauigkeit.
Denn was das Leben dieses unbändigen und ungebärdigen, dabei empfindsamen und verletzlichen Mannes im vollen Wortsinne war, liegt in der Fülle seines OEuvres eingeschlossen. Es mag ja interessant sein, etwa den Namen der legendären "Unsterblichen Geliebten" oder andere Details der äußeren Existenz Beethovens zu kennen. Aber die Dimension seines Daseins, die uns wirklich etwas angehen kann, die ist in der auch nach zweihundert Jahren unerschöpften Substanz seiner Werke zu erfahren. Was davon in der Summe an Fakten mitteilbar ist, das enthält dieses großartige Werkverzeichnis.
ULRICH KONRAD
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main