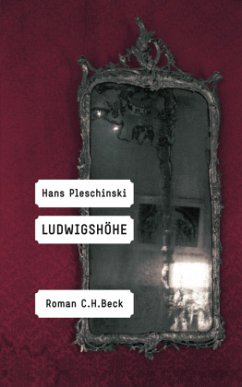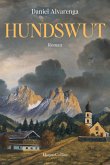Die drei Geschwister Berg - Clarissa, Monika und Ulrich - machen ein vertracktes Erbe. Ihr Onkel Robert bedenkt sie mit gewaltigen und weit verzweigten Vermögenswerten, allem voran mit einer Villa am Starnberger See. All dies könnte sie auf einen Schlag von ihrem ermüdenden, nicht unbedingt aussichtsreichen Existenzkampf befreien. Aber er macht ihnen eine Auflage: Sie müssen dieses Haus als Hort und Zufluchtsort für Lebensmüde betreiben und ihnen auch das eine oder andere nützliche Utensil bereithalten; nicht nur rechtlich eine Gratwanderung. Voller Skrupel und Ängste, aber auch scharf aufs Erbe öffnen die Geschwister die Villa an der Ludwigshöhe für eine stetig wachsende Zahl von "Finalisten". Da findet sich eine verzweifelte Verkäuferin neben dem Bühnenbildner mit gewissen körperlichen Defiziten ein, eine ausgebrannte Lehrerin neben einer vereinsamten Schauspielerin, eine medikamentenabhängige Witwe neben der liebeskranken Domina, ein bankrotter Verleger, aber auch eine erst 17jährige syrische Immanitin, die Angst hat, Opfer eines Ehrenmords zu werden. Während die Geschwister den Keller des Hauses mit praktischen Kühltruhen füllen, machen die Moribunden fast gar keine Anstalten mehr, ihrem dunklen Drang zu folgen. Die alte Villa erlebt ein Fest des Lebens - der kuriosen Beziehungen, Gespräche, Annäherungen und Abstoßungen, neuer Liebe und Lebensmutes - wie es als frisches, zeitgemäßes Panorama und in brillant-unterhaltsamer Form nur Hans Pleschinski inszenieren kann.
Ein großer Roman, der ein ebenso präzises wie farbiges Bild des gegenwärtigen Lebens bietet, der Versagungen, Überforderungen und Zwänge, aber auch der Wünsche, Sehnsüchte und der Möglichkeiten, die dem Dasein auch abzugewinnen sind.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Ein großer Roman, der ein ebenso präzises wie farbiges Bild des gegenwärtigen Lebens bietet, der Versagungen, Überforderungen und Zwänge, aber auch der Wünsche, Sehnsüchte und der Möglichkeiten, die dem Dasein auch abzugewinnen sind.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Heiter, todernst: Hans Pleschinskis Romanlaboratorium
Der Zauberberg liegt neuestens in Oberbayern. Hans Pleschinski erzählt von dort eine gutdokumentierte Geschichte: Drei Geschwister, Clarissa, Monika und Ulrich, schlagen sich mühselig durchs Leben, aber da vererbt ihnen plötzlich ein reicher Onkel aus Brasilien nach dem Tod seiner Frau ein Riesenvermögen: eine große Villa südlich von München, Bahnstation Höllriegelskreuth, dazu reichlich Bargeld und zukunftssichere Beteiligungen an Gazprom und an Heilquellen, an Hotelketten und an der Meerentsalzung in den Emiraten.
Doch hat Onkel Roberto den Löwenanteil des Erbes an eine Bedingung geknüpft: Die Erben sollen ein Jahr lang aus der Jugendstilvilla "Ludwigshöhe" ein Hospiz machen für Lebensmüde. Sie sollen ihnen beim Suizid kleine Hilfen leisten, zwar keine aktive Sterbehilfe, aber doch wirksame Unterstützung mit Plastiktüten und Stricken. Mit einigen Bedenken betreten sie die juristische Grauzone, aber sie brauchen das Geld und packen die Sache energisch an: Ulrich verteilt in Münchener Arztpraxen Visitenkarten, auf denen Unglückliche gefragt werden: "Reicht es? Reicht es wirklich? Und nicht mehr weiter?" Es folgt die Telefonnummer.
Dies ist der Plot: ein Experiment, ein Experiment an Menschen, auf dem Papier, halb märchenhaft, halb kriminalistisch. Der Leser fragt sich: Wie geht das aus? Fast sechshundert Seiten geben Antwort auf seine Fragen: Wer kommt und warum? Wer schafft den Absprung und wie? Kommen die Geschwister an ihr Geld?
Um das Ergebnis vorwegzunehmen: In zwei Fällen funktioniert die Fähre in die Unterwelt: Eine Italienerin und ein Herr Karl Lehmann haben sich das Leben genommen und ruhen nun zwischen Eisstangen unten im Keller. Es kommen reichlich Menschen: eine Domina aus Aichach, ein Radioredakteur aus München, eine Grundschullehrerin aus Augsburg, ein bankrotter Verleger, eine Kioskbesitzerin und eine große Dame der Bühne. Zuletzt sind das etwa zwanzig Leute, quer durch alle Schichten. Es gibt also genug Finalisten. Aber statt sich auf ihre selbstgesetzte letzte Stunde vorzubereiten und tapfer zur Tat zu schreiten, entdecken sie das Leben neu.
Das klingt nach einem philosophischen Thesenroman mit dem Motto "Erst durch den Tod wird das Leben zu einem befristeten Wunder". Aber auch diese Gewissheit wird bezweifelt. Monika braucht den Tod nicht, um zu leben. Hier geht es nicht um eine These, nicht um einen einsamen Protagonisten im Kampf zwischen Leben und Tod, sondern um ein pralles Bild des Lebens. Das Hospiz in idyllischer Lage erlaubt den neugierig-nüchternen Blick auf die Menschen in der Stadt. Die Aspiranten entfalten die ganz normale Verrücktheit, die sie mitbringen und die sie zurücktreibt. Oft herrschen der Zufall und unklare Konzepte. Da gibt es eine Frau, die gern tot sein wollte, aber sie will das Sterben vermeiden. Das Projekt geht schief. Die Geschwister hatten mit "implodierenden Seelen gerechnet, die stillschweigend, scheu, sauber ihren Handel mit der Schöpfung annullierten", aber stattdessen explodieren diese Seelen und werden laut. Sie gehen aus sich heraus. In der Distanz bringen sie auf den Punkt, was ihr gewöhnliches Leben war: Sie kondensieren ihre Essenz. Sie freunden sich mit sich und anderen wieder an. Einer von ihnen erfindet die Regel: "Bevor man in die Grube fährt, sollte man noch einmal zulangen." Sie sehen nicht mehr ein, warum sie die Gesellschaft von gescheiterten Existenzen befreien sollten, um ihr Krankheit und Alter, also unproduktive Randexistenzen, zu ersparen.
Die "Ludwigshöhe" heißt ein "Paradies", aber sie ist keins. Sie wird zunächst als Glücksfall und "lieblicher Ort", ganz in der Tradition des locus amoenus, eingeführt, aber entwickelt sich zum Laboratorium und zur Bühne. Hier werden die Torheiten des Alltagslebens konzentriert ausgestellt: Ordnungsfanatismus und Liebesenttäuschung, die Popanzen und die Niedertracht im Bayerischen Rundfunk, die Macht des Föns und die Verschlossenheit der Häuser: Es ist immer alles zu, ganz anders als in französischen Filmen. Nichts wird verschont. Nicht die Illusionen der Mütter über ihre Kinder, nicht der "inneruniversitäre Inzest" und schon gar nicht das Fernsehen. Pleschinski liefert einen Kurzkurs in Dachauer Heimatkunde und klärt auf: Unsterblichkeit wäre ein Fluch.
Die drei Geschwister sehen, dass ihr Projekt scheitert. Es gibt genug "triftige Verzweiflung", aber zu wenige entschlossene Finalisten. Die Erben sollen den Abschied erleichtern, sie drängeln, drücken aufs Tempo und erhöhen das Tagesgeld. Manchmal packt sie die Ungeduld. Dann rufen sie einem Kunden schon einmal zu: "Na, ist's bald soweit?", aber das bringt nichts. Die Lebhaftigkeit vorm Untergang nimmt nur noch zu. Es gibt Gelage und sexuelle Annäherungen der verschiedensten Art. Das Buch endet weder mit der sensationellen Sprengung der "Ludwigshöhe" noch mit einem Besuch der Polizei, schon gar nicht mit kollektivem Suizid. Die Geschwister bekommen ihr Geld nie. Der Schluss klingt undramatisch: "Die Gestalten verloren sich im Dunkel."
Kann daraus ein guter Roman werden? Er ist es geworden. Ich habe seit Jahren kein so gutes Erzählbuch gelesen. Nahezu sechshundert Seiten - das ist viel. Aber sie halten in Atem. Trotz der tristen Szenerie habe ich viel gelacht. Dieses Buch gibt auf eine glasklar gestellte Ausgangsfrage eine unendlich vielfältige, eine lebensfarbige Antwort. Und vor allem ist es gut und ohne tiefsinnige Ziererei geschrieben. Pleschinski beherrscht alle Tonarten: lyrische Intermezzi, lakonische Dialoge - beinahe wie bei Beckett, geschliffene Debatten - nicht ellenlang wie im "Zauberberg", realistische Fiktionen beinahe wie bei Musil, gesellschaftskritische Analyse, aber nicht so rührend wie bei Thomas Bernhard. Klar und knapp beinahe wie Kafka. Frech und frisch, Ross und Reiter nennend - beinahe wie Heine.
Pleschinski schreibt seinen eigenen intellektuellen und sprachlichen Stil. Er hat Vorbilder in der Kunst, wie man aus der Distanz das verlorene Leben einer Stadt zeichnet: Dante zuerst, den er am Schluss demonstrativ zitiert, aber auch Boccaccio, der in ländlich-harmonischer Umgebung den urbanen Verfall beschreibt. Dieses Buch handelt nicht von der Seelentiefe eines Einzelnen, sondern von der Verflachung im Ganzen. Es hat nicht einen Helden, sondern etwa zwanzig. Und es lässt die Millionen ahnen, denen es auch "reicht" und die gerne tot wären, ohne zu sterben.
Dieses Buch ist originell, todernst und heiter. Seine brillante Prosa gibt zu denken und liest sich mit Vergnügen. Und der nächste Roman von Hans Pleschinski vermutlich auch.
KURT FLASCH
Hans Pleschinski: "Ludwigshöhe". Roman. Verlag C. H. Beck, München 2008. 579 S., geb., 24,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Wow! Kurt Flasch kann sich gar nicht erinnern, wann zuletzt er ein so großartiges "Erzählbuch" gelesen hat. Die von ihm bemühten Vergleiche, um die Sensation dieser Lektüre zu beschreiben, reichen von Beckett über Heine bis Musil. Dabei hört sich der Plot erst einmal wie eine etwas papierne Fallstudie an: Drei Geschwister, die auf Anweisung ihres Erbonkels eine Art Zauberberg für Lebensmüde gründen, um zu sehen, ob sich passiv Sterbehilfe leisten lässt. Hmm. Flasch aber kann bald feststellen, dass Hans Pleschinski nicht nur ein glänzender Stilist ist, sondern auch den nüchtern-neugierigen Blick auf den Stadtmenschen und seine Spleens beherrscht. Das von den Geschwistern initiierte Projekt, freut sich Flasch, gerät zum Katastrophen-Panorama, das die Unsterblichkeit schließlich als Fluch erscheinen lässt. Dabei strapaziert der Autor außer den grauen Zellen auch gehörig die Lachmuskeln des Rezensenten. Ein Buch, jubelt Flasch, "originell, todernst und heiter".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»[...] ein Buch voller Lebenskunst und diabolischer Humanität.« -- Jens Bisky, Süddeutsche Zeitung 07.12.2010
»Herrlich morbide Gesellschaftssatire à la Zauberberg.« -- Journal München April 2011
»Herrlich morbide Gesellschaftssatire à la Zauberberg.« -- Journal München April 2011
[...] ein Buch voller Lebenskunst und diabolischer Humanität. Jens Bisky Süddeutsche Zeitung 20101207