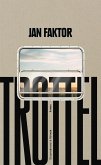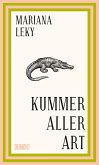Daniela Dröscher erzählt vom Aufwachsen in einer Familie, in der ein Thema alles beherrscht: das Körpergewicht der Mutter. Ist diese schöne, eigenwillige, unberechenbare Frau zu dick? Muss sie dringend abnehmen? Ja, das muss sie. Entscheidet ihr Ehemann. Und die Mutter ist dem ausgesetzt, Tag für Tag.
»Lügen über meine Mutter« ist zweierlei zugleich: die Erzählung einer Kindheit im Hunsrück der 1980er, die immer stärker beherrscht wird von der fixen Idee des Vaters, das Übergewicht seiner Frau wäre verantwortlich für alles, was ihm versagt bleibt: die Beförderung, der soziale Aufstieg, die Anerkennung in der Dorfgemeinschaft. Und es ist eine Befragung des Geschehens aus der heutigen Perspektive: Was ist damals wirklich passiert? Was wurde verheimlicht, worüber wurde gelogen? Und was sagt uns das alles über den größeren Zusammenhang: die Gesellschaft, die ständig auf uns einwirkt, ob wir wollen oder nicht?
Schonungslos und eindrücklich lässt Daniela Dröscher ihrkindliches Alter Ego die Jahre, in denen sich dieses »Kammerspiel namens Familie« abspielte, noch einmal durchleben. Ihr gelingt ein ebenso berührender wie kluger Roman über subtile Gewalt, aber auch über Verantwortung und Fürsorge. Vor allem aber ist dies ein tragik-komisches Buch über eine starke Frau, die nicht aufhört, für die Selbstbestimmung über ihr Leben zu kämpfen.
»Lügen über meine Mutter« ist zweierlei zugleich: die Erzählung einer Kindheit im Hunsrück der 1980er, die immer stärker beherrscht wird von der fixen Idee des Vaters, das Übergewicht seiner Frau wäre verantwortlich für alles, was ihm versagt bleibt: die Beförderung, der soziale Aufstieg, die Anerkennung in der Dorfgemeinschaft. Und es ist eine Befragung des Geschehens aus der heutigen Perspektive: Was ist damals wirklich passiert? Was wurde verheimlicht, worüber wurde gelogen? Und was sagt uns das alles über den größeren Zusammenhang: die Gesellschaft, die ständig auf uns einwirkt, ob wir wollen oder nicht?
Schonungslos und eindrücklich lässt Daniela Dröscher ihrkindliches Alter Ego die Jahre, in denen sich dieses »Kammerspiel namens Familie« abspielte, noch einmal durchleben. Ihr gelingt ein ebenso berührender wie kluger Roman über subtile Gewalt, aber auch über Verantwortung und Fürsorge. Vor allem aber ist dies ein tragik-komisches Buch über eine starke Frau, die nicht aufhört, für die Selbstbestimmung über ihr Leben zu kämpfen.
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Selten loben Rezensenten Romane für ihre große Seitenzahl. Rezensentin Judith von Sternburg tut dies. Ausgangssituation und Handlung ließen sich zwar auch in wenigen Worten beschreiben, doch Daniela Dröschers "Lügen meiner Mutter" braucht dennoch "dringend" jede seiner 444 Seiten, um auf die ihm eigene originelle und packende Weise von Elas Problem zu erzählen, so die Rezensentin. Ela ist ein Kind, als die Geschichte einsetzt, und sie hat ein Problem. Dass ihre dicke Mutter ihr Problem ist, glaubt sie, weil ihr Vater das glaubt: Der meint seine Frau halte ihn davon ab, jener unscheinbare Durchschnitts-BRD-Bürger zu sein, der zu sein er anstrebt. Doch die Übergewichtigkeit von Elas Mutter, das begreifen sowohl Ela als auch die Lesenden Seite für Seite, ist tatsächlich kein Problem, sondern ein Symbol. Der Vater ist das Problem, erfahren wir. Gespannt und mitfühlend liest man, wie Elas Vater seine Frau immer wieder triezt, sie zum Abnehmen drängt und wie Ela seine Scham übernimmt. Entbehrlich scheinen zunächst die Einschübe, in denen die Autorin ihren Leserinnen und Lesern direkt und nüchtern erklärt, was man auch ohne dies verstehen würde. Allerdings, so geht der Kritikerin schließlich auf, sind diese Einschübe auch eine Möglichkeit, die Mutter aus einer anderen Perspektive, nicht nur der der Tochter zu zeigen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Daniela Dröscher erzählt vom Drama einer Ehe
Kann man seinem Vater verzeihen, wenn er die eigene Mutter zu dick findet und sie ständig missbilligend beäugt? Sie zu einer "FdH"-Diät, sprich "Friss die Hälfte", nahezu erpresst? Ihr Geld verweigert, als stünde das Familieneinkommen allein ihm zu? Vielleicht kann ein Kind seinem Vater so etwas später verzeihen, doch in diesem Buch erfährt man nicht, ob es möglich ist. In Daniela Dröschers Roman "Lügen über meine Mutter" geht es nur um diese Mutter, die in ihrer gesamten Ehe als zu dick galt und deren Gewicht - so absurd es klingt - der Grund für jegliches Versagen ihres Mannes sein sollte.
Dröscher ist wie ihre Protagonistin Ela 1977 in Rheinland-Pfalz geboren. Ob es eine autobiografische Grundlage fürs Buch gibt, bleibt offen, doch die Zwischenkapitel lassen es vermuten. Denn in vier aus der Sicht von Ela geschilderten Kindheitsjahren gibt es auch immer wieder Unterbrechungen einer allwissenden Ich-Erzählerin, die versucht zu erklären, wie es zwischen den Eltern so weit kommen konnte. Und aus Gesprächspassagen mit der Mutter schließt man erleichtert, dass es irgendwann zur Trennung kam.
Elas Kindheit ist geprägt von Streit zwischen Vater und Mutter. Die will ein Diplom in Französisch machen, um bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu haben - was er nur erlaubt, wenn sie abnimmt und den Kurs selbst zahlt. Später dann kommt sie ohnehin nicht mehr zum Lernen, weil sie mit dem zweiten Kind schwanger ist und sich um ihre an Alzheimer erkrankte Mutter kümmern muss. Der Vater macht derweil allein Skiurlaub. Die düstere Familienatmosphäre wird verstärkt durch das Dorf, in dem sie wohnen. Wegen des Mannes ist das Ehepaar nach Elas Geburt aus München zurück in dessen Heimat gezogen, in der die Mutter immer eine Fremde bleibt. Während er den Dialekt spricht und ein intaktes soziales Umfeld besitzt, bleibt sie meist einsam. Mit einer eifersüchtigen Schwiegermutter im Haus und dem Wunsch des Vaters, im Dorf zu protzen - am besten auch mit einer dünnen Frau -, beginnt der Untergang der Mutter.
Denn Sellerie-, Farb- und "FdH"-Diäten sowie der Gang zu den "Weightwatchern" helfen nichts, und der Ballon, den sich die Mutter trotz Risiken in den Magen einsetzen lässt, um den Hunger zu stoppen, kann auch nichts ausrichten. Wegen ihrer Figur darf sie nicht mit in den Badeurlaub, und die Dorfbewohner tuscheln, wenn sie die dicke fremde Frau sehen.
Dröscher zeigt mit ihrem Roman, wie ungerecht das Leben für Frauen noch vor dreißig Jahren war. Es macht wütend, von diesem Patriarchen zu lesen, dessen Miene, wie es heißt, das Klima in der Familie bestimmt. Der noch nie einen Teller abgewaschen, kein Hemd gebügelt und am Tag der Entbindung seiner Frau mit anderen Dorfbewohnern trinken war.
Ein glückliches Ende bietet dieser Roman nicht. Vielmehr eine Akkumulation der Misere einer Frau, die immer dicker wird und ohne jegliche Anerkennung für ihre Arbeit lebt. Ihr Leben ist eine Qual, wie für viele andere Frauen auch, die selbstlos Verzicht leisteten, und sie endet erst, als die Kinder aus dem Haus sind. Erst danach kann Ela die Äußerungen ihres Vaters über die Mutter als das erkennen, was sie waren: Lügen. Zu spät für eine Familie, von der man sich wünscht, sie wäre schon früher zerbrochen. ANNA FLÖRCHINGER
Daniela Dröscher: "Lügen über meine Mutter". Roman.
Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2022. 448 S., geb., 24,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»ein kluger und packender Roman über subtile Gewalt in den eigenen vier Wänden« Woman, Österreich 20221219